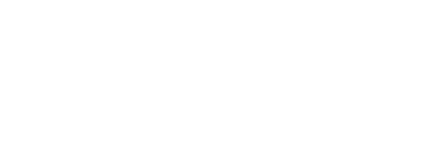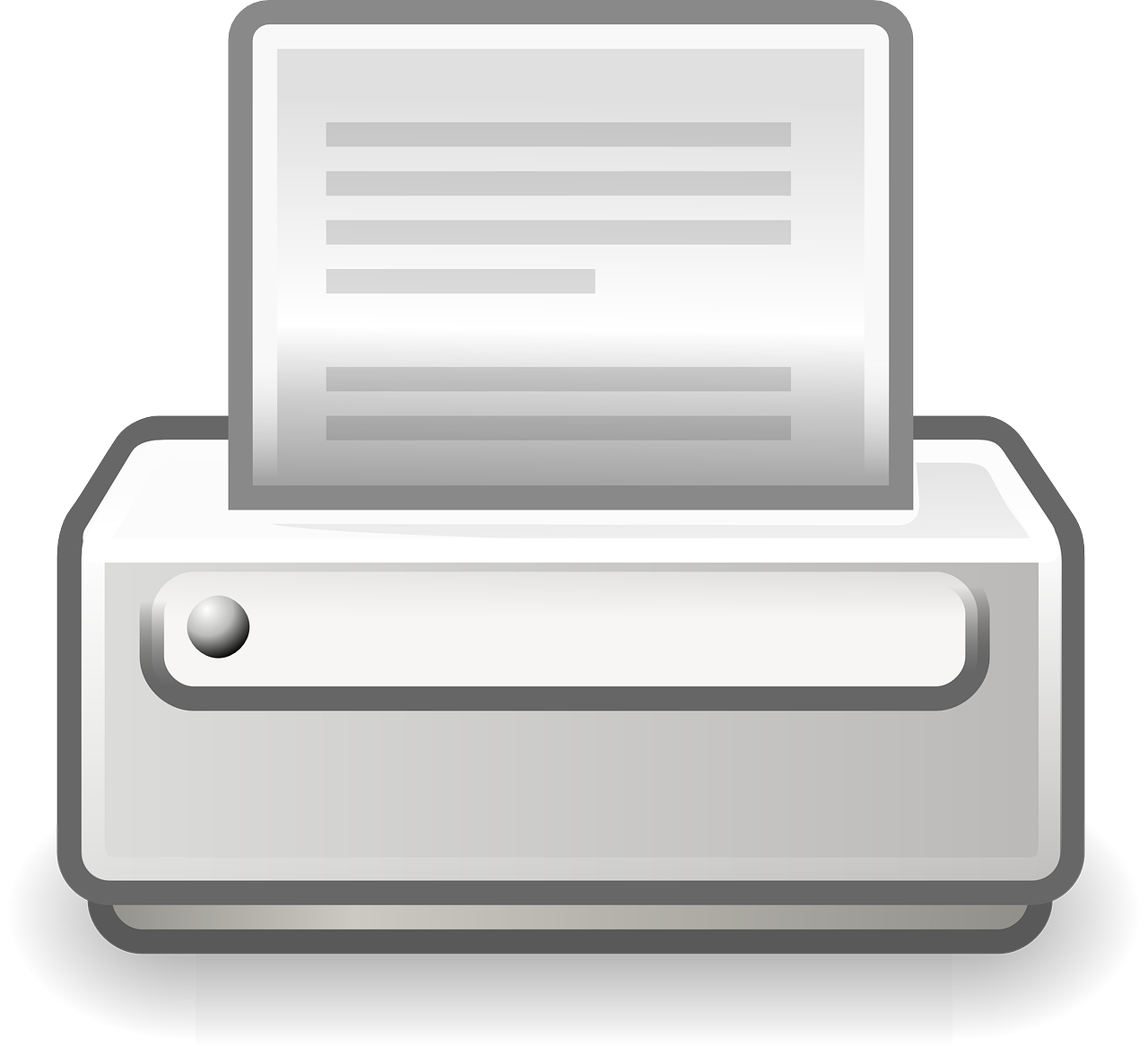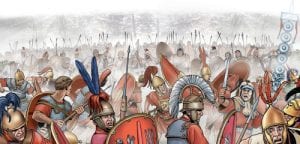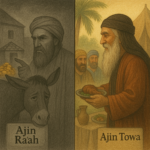Wochenabschnitt Paraschat Pekudej: Warum bewahrte Mosche seine Beracha bis Ende Paraschat Pekudej auf?
Rav Frand zu Paraschat Pekudej 5784 – Beitrag 1
Ergänzungen: S. Weinmann
Weitere Artikel zum Wochenabschnitt Paraschat Pekudej, finden Sie hier
Paraschat Pekudej ist die letzte der fünf Paraschot in der zweiten Hälfte des Sefer Schemot, welche die Details über den Bau des Mischkans (Stiftzelts) enthält. Falls wir ein Gefühl der Errungenschaft empfinden, dass wir diese fünf Paraschot gelernt haben, können wir uns die Freude vorstellen, welche die Menschen beim bedeutenden Anlass in Paraschat Pekudej empfanden, als das Mischkan zum ersten Mal aufgebaut wurde. Wir lesen in der Parascha, dass “Mosche die ganze Arbeit betrachtete, und siehe, sie hatten sie ausgeführt; wie der Ewige es befohlen hatte, also hatten sie sie ausgeführt, und Mosche segnete sie” (Schemot 39:43).
Raschi zitiert Chasal mit den Worten, dass der Segen, den Mosche ihnen gab, wie folgt lautete: “Möge die G”ttliche Schechina (Allgegenwart) in der Arbeit eurer Hände ruhen. Wijhi Noam Haschem Elokejnu alejnu, uMa’asej Jadejnu konenu alejnu… – Möge das Wohlgefallen des Ewigen, unseres G-ttes auf uns ruhen, und das Werk unserer Hände fördern… “. Jetzt, da alles beendet war, benschte (segnete) er sie, dass Haschem Seine Schechina auf dem Volk und auf dem Werk ihrer Hände ruhen lassen sollte. Raschi fügt hinzu, dieser Segen ist eines von den elf Kapitel in Tehillim (Psalm), die Mosche betete, beginnend mit ‘Tefila leMosche…’ (Tehillim Kapitel 90-100).
Raw Simcha Schepps, der ein Rosch Jeschiwa in Tora Wodaas war, machte eine interessante Betrachtung. Er sagte, dass es logischer gewesen wäre, dem jüdischen Volk diese Beracha zu Beginn des Baus des Mischkans zu geben. Der Passuk zu Beginn von Paraschat Teruma lautet: “Sie sollen Mir ein Heiligtum errichten, sodass Ich mitten unter ihnen wohnen kann” (Schemot 25:8). Diese Beracha “möge die G”ttliche Schechina in der Arbeit eurer Hände ruhen” wäre in jenem Moment eine sehr angemessene Beracha gewesen. Warum behielt Mosche diesen Segen für das Ende des Prozesses auf?
Raw Schepps beantwortet die Frage aufgrund eines Passuks in Tehillim, den die meisten von uns kennen: “Mi ja’ale beHar Haschem umi jakum Bimkom Kodscho – Wer kann auf den Berg des Ewigen aufsteigen und wer kann an Seiner heiligen Stätte stehen?” (Tehillim 24:3). Alle Kommentatoren sagen, dass dieser Passuk auf die Tatsache hinweist, dass es zwei verschiedene Herausforderungen im Leben gibt. Die erste Herausforderung ist “Wer kann zum Berg von Haschem aufsteigen?” Dies bedeutet: Wer hat die Charakterstärke und den Elan, zum Berg von Haschem aufzusteigen? Es gibt jedoch eine noch grössere Herausforderung, als dorthin zu gelangen. Die grössere Herausforderung ist, wenn er schon auf dem Berg angelangt ist, nämlich dort oben bleiben zu können.
Tatsächlich ist es leichter, auf den Berg von Haschem aufzusteigen, als dort zu verbleiben. Wiederholung und Langeweile treten ein. Die tagtägliche Monotonie macht sich bemerkbar. Auf dem Berg des Herrn zu bleiben, ist eine viel schwierigere Aufgabe, als überhaupt dorthin zu gelangen. In den Monaten August/September, während dem Elul Sman in den Jeschiwot, ist jeder enthusiastisch, denn wir stehen vor den ‘Jamim Nora’im – furchterregende Tage’. Wenn wir das Ende des Monats Adar erreichen, steht nur die Elite noch auf dem Gipfel des Bergs von Haschem. Dies ist in vielen Bereichen des Lebens so.
Als wir Bar-Mizwa Jungen waren und begannen, Tefillin zu legen, war das Ritual mit grosser Erregung verbunden. Wenn man Tefillin schon vierzig oder fünfzig Jahre lang legt, geht ein Teil dieses Enthusiasmus verloren. Die Wahrheit ist, dass dies auch bei den meisten Ehen der Fall ist. “Das erste Jahr” ist grossartig. Es sind dies die Flitterwochen. Wenn man jedoch schon zehn, zwanzig oder dreissig Jahre verheiratet ist, scheint die Aufregung dieses ersten Jahrs nicht mehr anzudauern.
Wir dürfen nicht zulassen, dass dies geschieht. Die Herausforderung ist nicht nur “Wer wird auf den Berg von Haschem aufsteigen?”, um den Gipfel des Berges zu erreichen. Die Herausforderung ist noch grösser, nämlich “wer wird an Seiner heiligen Stätte stehen bleiben können?”
Zu Beginn des Baus des Mischkans war natürlich jeder begeistert. Denken Sie an den Zusammenhang. Sie hatten die Sünde des Goldenen Kalbs begangen. Der Allmächtige hatte gedroht, sie zu vernichten. Mosche Rabbejnu betete für sie, und kam schliesslich am Jom Kippur vom Berg Sinai mit den zweiten Luchot (Bundestafeln) zurück. Sie begannen am Tag nach Jom Kippur, das Mischkan zu bauen. Jeder nahm mit Begeisterung und Ergriffenheit daran teil. Dies ist die Phase des “Wer wird den Berg von G”tt besteigen?”
Jetzt jedoch, da das Mischkan gebaut ist, schwächt sich die Begeisterung ab. Jetzt beginnt die tagtägliche sich wiederholende Routine. Morgen, Abend, Morgen, Abend…
Wir bringen tagtäglich dasselbe Korban Tamid (ständige Opfer).
Deshalb ist Mosche Rabbenu’s Beracha für sie: “Möge es Sein Wille sein, dass Seine G”ttliche Schechina im Handwerk eurer Hände verweilt.” In anderen Worten, möge der anfängliche Enthusiasmus während der ganzen andauernden Phase der täglichen Operation des Mischkans erhalten bleiben.
Raschi, Akronym für Rabbi Schlomo ben Jizchak (1040-1105); Troyes (Frankreich) und Worms (Deutschland); „Vater aller TENACH- und Talmudkommentare“.
Rabbi Simcha Avraham ben Schimon HaKohen Sheps (1908-1998); geb. in Wysokie Mazowieckie (Russisches Reich, heute Polen). Sein Vater starb, als er ein Kleinkind war, und Rabbi Sheps wurde von seiner Mutter und seinem Grossvater in der nahen gelegenen Stadt Sheptakova aufgezogen. Im Alter von elf Jahren ging er zum Studium in die Jeschiva Ketana von Bransk und dann in Oma. Nach seiner Bar-Mizwa ging Rabbi Simcha zum Studium in die Jeschivat Ohel Torah-Baranovitsch, wo er unter Rav David Rappaport (dem Mikdasch David), Rav Leib Gavia und Rav Elchanan Wasserman studierte. 1927 ging er zum Studium in die Mirer Jeschiva, wo er zu einem der “Löwen der Jeschiwa” wurde. 1936 ging er an die Brisker Jeschiva unter Rabbi Jizchak Zeev Soloveitschik.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs floh Rabbi Sheps mit der Mirer Jeschiva nach Wilna und von dort nach Kobe, Japan mit der Transsibirischen Eisenbahn und einer kurzen Bootsfahrt. In Kobe wollten viele der Jeschiva-Studenten, dass die amerikanische Botschaft ihnen Zugang in die Vereinigten Staaten gewähre. In seinem Interview in der Botschaft wurde Rabbi Sheps gefragt, wie er sich in den Vereinigten Staaten unterstützen wolle. Er beantwortete die Frage mit den Worten, dass er eine Übersetzung der Bibel und Kommentare veröffentlichen werde. Letztlich war er einer der wenigen Leuten, die aus Japan in die Vereinigten Staaten reisen durften.
Bei seiner Ankunft in New York schloss sich Rabbi Sheps den Mitarbeitern der Jeschiva Torah Vodaath an. 1943, als Rav Heiman, einer der Leiter von Torah Vodaath, krank wurde, übernahm Rabbi Simcha seinen Schiur (Klasse).
Rabbi Sheps litt in den 48 Jahren, die er an der Jeschiva Torah Vodaath unterrichtete, an einer lebensbedrohlichen Krankheit. Trotzdem gab er seinen Tausenden von Studenten weiterhin mit Energie und Enthusiasmus seine Schiurim weiter. Rabbi Sheps starb am 5. November 1998 und wurde auf dem Har Hasejtim in Jerusalem begraben.
Viele seiner Draschot (Vorträge) und Schmussen (Reden) wurden von seinen Schülern aufgezeichnet und in einem Sefer mit dem Titel Moreschet Simchat HaTorah veröffentlicht. Seine Schiurim über den Traktat Bava Kama wurde von seiner Familie im Sefer Divrej Simcha veröffentlicht.
______________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
______________________________________________________________________________
Copyright © 2024 by Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com
Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.