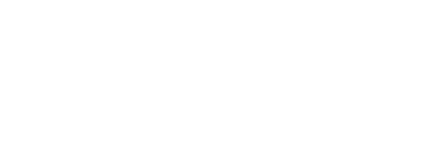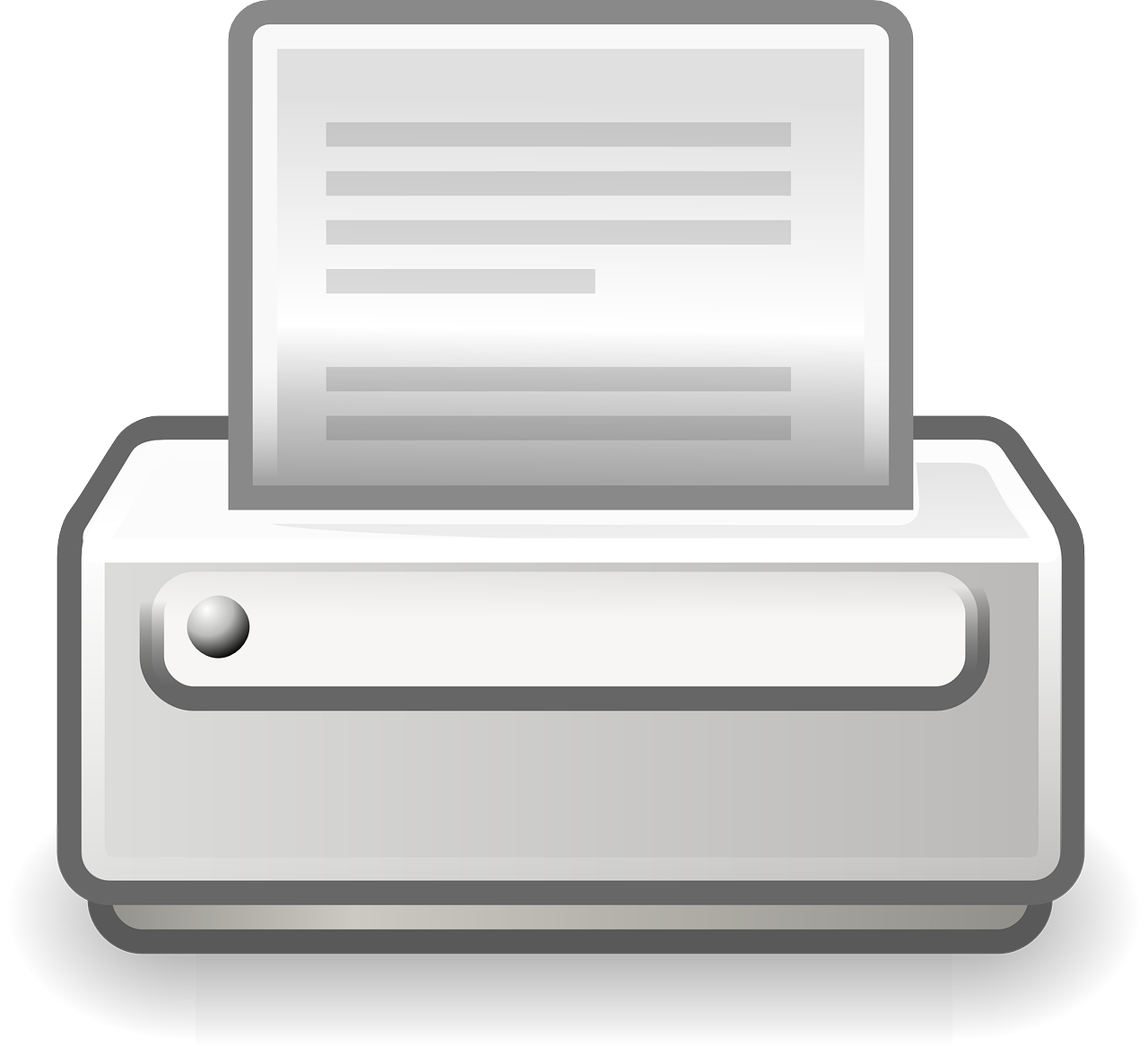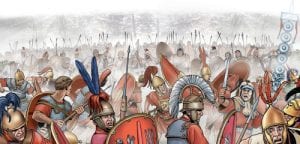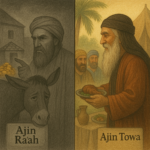Wochenabschnitt Paraschat Ki Tissa: Nicht der Kampfruf, sondern der Ruf des “Anot”
Rav Frand zu Paraschat Ki Tissa 5784 – Beitrag 2
Ergänzungen: S. Weinmann
Weitere Artikel zum Wochenabschnitt Paraschat Ki Tissa, finden Sie hier
Wir finden in der dieswöchigen Parascha einen Vers, der schwer zu verstehen ist. Als Mosche mit den zwei Gesetzestafeln vom Berg Sinai hinabstieg, sagt die Tora: “Jehoschua hörte die Stimme des Volkes, wie es lärmte, da sagte er zu Mosche: ‘Ein Kriegsgeschrei ist im Lager.’ Mosche aber sprach: ‘Dies ist kein Geschrei, wie es Sieger erheben (Kol Anot Gewura), und auch nicht ein Geschrei, wie es Unterliegende erheben (Kol Anot Chaluscha), KOL ANOT höre ich'” (Schemot 32:17-18).
Mosche und Jehoschua hörten lautes Geschrei aus dem israelitischen Lager. Jehoschua legte Mosche nahe, dass sie ein Kampfgeschrei hörten. Mosche widersprach ihm: Er sagte zu Jehoschua, dass was sie hörten, nicht ein Geschrei von militärisch Siegenden oder von militärisch Unterliegenden sei. Dies sei ein Geschrei von “Anot”. Was ist die einfache Interpretation des Ausdrucks ‘Kol Anot’? (Im Prinzip lässt Mosche alles offen, denn ‘Anot’ ohne Zusatz macht keinen Sinn). Was bedeutet dies?
In Massechet (Traktat) Ta’anit sagt der Talmud Jeruschalmi (4:5), dass Mosches Antwort an Jehoschua kritisch war. Er sagte ihm: ‘Ein Mensch, der eines Tages der Führer von 600’000 Juden sein wird, kann nicht den Unterschied zwischen einer und der anderen Art von Geschrei unterscheiden’? Was genau war Mosches Kritik an Jehoschua?
Raw Schwab gibt eine wunderschöne Erklärung in seinem Sefer: Jehoschua hörte dieses Geschrei und verkündete: Dies sind Schreie der Rebellion im Lager. Dies ist das Geschrei von Menschen, die sich vom Ribbono schel Olam (Herr der Welt) abgekehrt haben und die ein götzendienerisches Goldenes Kalb geschaffen haben. Dies ist eine Revolte im Lager! Dies ist der “Kol Milchama beMachane (Kampfgeschrei im Lager, von Befürworter und Gegner der Revolte)”.
Mosche schalt ihn: “Jehoschua, als zukünftiger Führer musst du das Wesen dieses Geschreis verstehen. Dies sind keine Schreie von Leuten, die siegreich sind. Dies sind keine Schreie von Leuten, die einen Krieg verlieren. Dies ist ein “Kol Anot”. Raw Schwab erklärt, dass das Wort ‘Anot’ (Ajin-Nun-Waw-Taw) etymologisch mit dem Wort ‘inuj’ (Pein) – wie schon Raschi zur Stelle bemerkt – verbunden ist. Es ist das Geschrei eines Volkes, das Schmerzen hat. Sie leiden, weil sie nicht wissen, was mit mir geschehen ist. Sie befürchten, dass sie ihren Führer verloren haben. Sie sind wie ein Baby, das schreit, weil es seine Mami verloren hat.” Sie rebellieren nicht gegen den Herr der Welt. Sie schreien, weil sie verängstigt sind und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Dies ist ein Kol Anot – ein Inuj – ein Schmerzensschrei und eine Verwirrung.
Mosche kritisiert Jehoschua, weil er die Schreie falsch deutete, denn ein wahrer jüdischer Führer muss den Unterschied zwischen einem Geschrei der Rebellion und einem Geschrei des Schmerzes erkennen können. Ein Führer muss die Ursache des Schmerzes von Menschen wahrnehmen können.
Diese Lektion geht auch für uns alle an. Als Eltern oder Lehrer müssen wir richtig verstehen können, was hinter dem schlechten Benehmen unserer Kinder oder unserer Schüler steht. Es könnte Chuzpe oder Rebellion sein, aber es könnte auch etwas Anderes sein. Manchmal ist dies nicht der wahre Grund. Der einzige Weg, wie solch eine ‘Rebellion’ abgewendet werden kann, ist, wenn wir die wahre Ursache verstehen wollen.
Kinder sagen manchmal verletzende Worte oder tun verletzende Dinge. Unsere anfängliche Reaktion könnte sein “Wie können sie so etwas sagen? Dies ist klare Chuzpe und Rebellion!” Nein! Manchmal liegt etwas Tieferes dahinter, die Wurzel dieses Benehmens ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, und wir müssen überlegen, wie wir reagieren sollten. Dies ist die Mussar-Lektion, die Mosche Rabbejnu Jehoschua gab. “Ein Mensch, der dazu bestimmt ist, ein Führer von 600’000 Juden zu werden, weiss nicht, zwischen einem und einem anderen Aufschrei zu unterscheiden?” Das Verstehen, was wirklich hinter dem Aufschrei liegt, ist der einzige Weg, wie ein Führer die Menschen auf den richtigen Weg zurückbringen kann.
Raschi, Akronym für Rabbi Schlomo ben Jizchak (1040-1105); Troyes (Frankreich) und Worms (Deutschland); „Vater aller TENACH- und Talmudkommentare“.
Rav Schimon Schwab (1908 – 1995): geb. in Frankfurt am Main. Rav Schimon Schwab war ein orthodoxer Rabbiner und Gemeindeführer in Deutschland und den Vereinigten Staaten.
Rav Schwab schloss die Realschule in Frankfurt ab, die Religionswissenschaft und allgemeine Fächer in Übereinstimmung mit der von Rabbi Hirsch propagierten ‘Thora im Derech Erez-Ideologie’ vermittelte. Im Jahr 1926, im Alter von 17 Jahren, reiste er nach Tels (Litauen) um dort in der Telser Jeschiwa zu studieren. Nach drei Jahren intensiven Talmud-Studium in Tels verbrachte er noch anderthalb Jahre in der Mirer Jeschiwa. Es war nicht sehr üblich, dass deutsch-jüdische Studenten in osteuropäischen Jeschiwot studierten, aber zwei von seinen Brüdern (Mosche und Mordechai) folgten ihm später in demselben Weg.
Im Frühjahr 1930 verbrachte er ein Wochenende mit dem Chafez Chajim. Der Besuch machte einen starken Eindruck auf ihn, und er bezog sich später sein ganzes Leben lang in öffentlichen Reden auf diese Begegnung.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, nahm er im Februar 1931, noch unverheiratet, die Position eines Assistenten-Rabbiner in Darmstadt an. Im Oktober 1931 heiratete er. Im September 1933 nahm er den Posten des Gemeinderabbiner in Ichenhausen, Bayern an. In Ichenhausen arbeitete er auch hart daran, eine traditionelle Jeschiwa zu gründen, in der Mischna und Talmud unterrichten würde. Die Jeschiwa begann, geriet aber sofort in Schwierigkeiten, da Drohungen von lokalen Nazi-Aktivisten ausgingen. Am Ende wurden die Studenten nach einem Tag nach Hause geschickt, und dieser Vorfall inspirierte wahrscheinlich Rabbi Schwab, sich für eine Position im Ausland zu bewerben.
Durch den amerikanischen orthodoxen Rabbiner Dr. Leo Jung nahm er Kontakt mit einer Gemeinde namens Schearith Israel in Baltimore auf. Er reiste in die Vereinigten Staaten, und nach einer Probezeit wählte ihn die Gemeinde zum Rabbiner. Die Familie konnte daher ein Visum beantragen und dem Holocaust entkommen.
In Baltimore wurde Rav Schwab auch ein lokaler Führer der Orthodoxie und veranstaltete einige Jahre nach seiner Ankunft die jährliche Konferenz der Agudath Israel. Er war an der Gründung des Bejt Ja’akov, der ersten jüdischen Schule für Mädchen, beteiligt.
1958 wurde Schwab eingeladen, Rabbiner Joseph Breuer bei der Führung der deutsch-jüdischen Gemeinde Khal Adath Jeshurun in Washington Heights in New York City zu begleiten. Diese Gemeinde, die weithin als “Nachfolger” des Frankfurter “IRG” (Israelitischen Religionsgesellschaft) angesehen wurde, stand Rabbi Schwab am Herzen, und mit Rabbi Breuers zunehmendem Alter und seiner Schwäche übernahm er bis zu dessen Hinschied im Jahr 1980 viele Führungsrollen.
Von da bis 1993 führte er die Gemeinde allein. Er lehrte und lehrte weiter, aber sein Gesundheitszustand verschlechterte sich und er starb im Alter von 86 Jahren am Purim Katan (14. Adar I) 1995. Sein Nachfolger wurde Rabbi Zechariah Gelley, der Rosch Jeshiwa von Sunderland (GB), der bereits einige Jahre zuvor als zweiter Rav der Kehilla beigetreten war.
Rav Schwab veröffentliche mehrere populäre Schriften und Werke zu verschieden Themen, wie “Rav Schwab on Prayer” (zu den Gebeten), These and Those (Thora im Derech Erez), Bejt Haschoewa (zu Ikweta Dimschicha/Zeit vor Maschiach), Ma’ajan Bejt Haschoewa (Gedanken zum Chumasch), etc.
______________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
______________________________________________________________________________
Copyright © 2024 by Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.com und www.juefo.ch
Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.