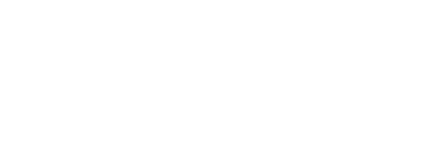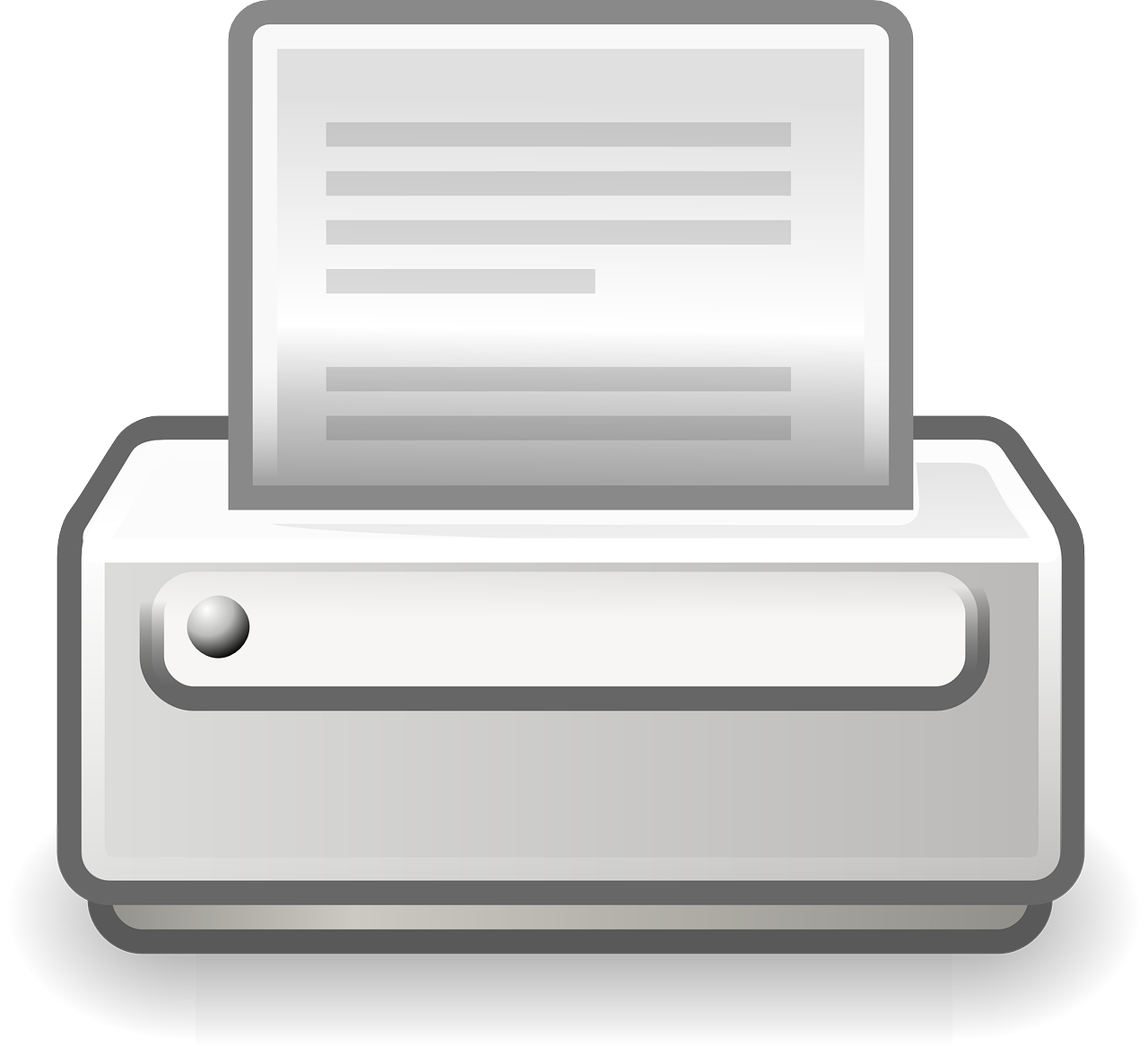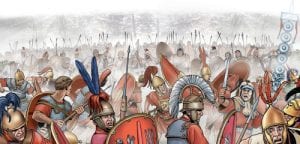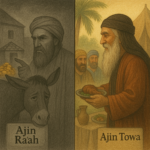Wochenabschnitt Paraschat Teruma: Die Symbolik des Aron HaEjdut (Bundeslade)
Rav Frand zu Paraschat Teruma 5784
Ergänzungen: S. Weinmann
Weitere Artikel zum Wochenabschnitt Paraschat Mischpatim, finden Sie hier
Trotz der Tatsache, dass wir heute kein Mischkan (Stiftzelt) oder Bejt Hamikdasch (Tempel), oder dessen verschiedene Geräte und Einrichtungen haben, sind alle Kommentatoren bemüht, wichtige symbolische Lektionen aus der Beschreibung der Bestandteile des Mischkan, die in der Parascha erwähnt werden, zu ziehen, wie auch aus der Art und Weise, wie sie gebaut wurden.
Die Tora beschreibt den Aron und dessen Masse. “Sie sollen eine Lade aus Schittim- (Zedern-, Akazien-) Holz machen, zwei und eine halbe Ama (Elle) lang, ein und eine halbe Elle breit und eine und eine halbe Elle hoch. Du sollst sie mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen, und du sollst oben ringsherum einen goldenen Kranz daran machen” (Schemot 25: 10-11).
Verschiedene Kommentatoren sehen eine Bedeutung in der Tatsache, dass der Aron in Massen von halben Amot (Ellen) (2.5 x1.5 x1.5) gebaut wurde, im Gegensatz zu den anderen Geräten, die grösstenteils in Einheiten von ganzen Ellen (Amot) gebaut wurden.
Der Ba’al Haturim sagt, dass nachdem die Bundeslade die Tora beherbergt, sie den Talmid Chacham (Tora-Gelehrten) versinnbildlicht. Die Lektion ist, dass der Talmid Chacham seine Bescheidenheit beibehalten muss und sich in halben Masseinheiten sehen sollte (d.h. dass er bescheiden und bewusst sein sollte, dass er noch nicht sein volles Potential ausgeschöpft hat).
Der Kli Jakar bemerkt bezüglich derselben Frage in ähnlicher Weise, dass die Lektion für den Talmid Chacham ist, dass er immer denken sollte, dass seine Arbeit nur halb beendet ist. Er sollte immer hinaufschauen, auf andere die noch mehr Wissen besitzen als er. Sogar wenn man Schass (den Talmud) fertig lernt oder ein gewisses Niveau erreicht, sollte man seine Errungenschaft nur als “halb getan” betrachten.
Der Pardes Josef erwähnt eine ähnliche interessante Andeutung im Namen des Chida. In Massechet Sofrim wird gebracht, dass der Passuk “…Darosch Darasch Mosche…” (Wajikra 10:16) in der Sefer Tora in solcher Weise geschrieben werden muss, dass das Wort ‘Darosch’ am Ende einer Linie und das nachfolgende Wort ‘Darasch’ (in Hebräisch auf dieselbe Weise geschrieben – Daled/Rejsch/Schin) zu Beginn der nächsten Linie geschrieben wird. Der Chida erklärt dies auf wunderschöne Weise. Wenn man etwas erläutert (Darosch) und sich am Ende der Linie befindet und denkt “Ich bin schon fertig”, sagen wir ihm: “Nein, du bist nie fertig. Geh zum Beginn der nächsten Linie und beginn mit (Darasch) weiteren Erläuterungen.” All dies zeigt die Symbolik, die von verschiedenen Kommentatoren über die halben Ammot, die bei den Massen des Aron erwähnt werden, gefunden wurde.
Ein weiteres Beispiel der homiletischen Symbolik, die bei der Beschreibung der Kejlim (Geräte) des Mischkan ersichtlich wird, ist die Tatsache, dass die Stangen, die zum Transport des Aron verwendet wurden, nie von den Ringen – in die sie steckten – entfernt werden durften (Schemot 25:15). Obwohl der Schulchan (Tisch) und der Missbeach (Altar) auch Ringe und Stangen hatten, um sie zu transportieren, gilt das Gesetz, dass die Stangen nie von den Ringen entfernt werden durften, nur für den Aron. Was ist hier die Symbolik?
Die Kommentatoren erklären, dass beim Schulchan und bei dem Missbeach die Stangen aus strikt pragmatischen Gründen vorhanden waren, um sie zu tragen. Die Stangen des Aron jedoch stellen Leute dar, die die Tora stützen. Sie stellen das Volk dar, das die Rechnungen der Gemeinde, des Rabbiners und der Jeschiwot bezahlt. Wir sollten nie denken, dass irgendwann eine Zeit kommen wird, da wir die Leute, die die Tora unterstützen, nicht berücksichtigen werden. Sie werden immer ein wichtiger Bestandteil der ewigen Erhaltung der Tora unter dem jüdischen Volk bleiben. Die Stangen verbleiben im angesehenen Platz im Heiligtum, zusammen mit dem Aron selbst.
Dies entspricht der Botschaft, die unsere Weisen aus dem Passuk “Freue dich, Sewulun, wenn du ausziehst, und du Jissachar in deinen Zelten”, (Dewarim 33:18) ableiten. Chasal bemerken, dass Sewulun (der die Unterstützer der Tora darstellt), in diesem Passuk als erster erwähnt wird, um zu betonen, dass er auf der gleichen Stufe wie Jissachar steht (der diejenigen darstellt, die Tora lernen).
Dies bringt uns zur folgenden Frage. Die Tora lehrt: “Du sollst sie (die Lade) mit reinem Gold überziehen, von innen und aussen sollst du sie überziehen…” (Schemot 25:11). Raschi zitiert die Gemara (Traktat Joma 72b), dass Bezalel drei Arons (Kasten, Lade) machte, zwei aus Gold und einen aus Holz. Sie hatten alle vier Wände und einen Boden und sie waren oben offen. In anderen Worten bestand der Aron nicht wirklich gänzlich aus Gold. Er sah so aus, aber wurde in Wahrheit aus Holz hergestellt, überzogen mit goldenen Kästen von aussen und innen. Die Menora (der Leuchter) hingegen bestand aus reinem Gold. Warum wurde der Aron nicht auf dieselbe Weise hergestellt? Es war sicherlich nicht, weil sie sich einen Aron aus reinem Gold nicht leisten konnten! Was ist die Symbolik des hölzernen Inneren des Aron? Raw Simcha Schepps sl. (Rosch Jeschiwa in Tora Woda’at) bemerkt zu diesem Thema einen sehr interessanten Gedanken. Es besteht ein bedeutender Unterschied zwischen Gold und Holz. Gold ist ein äusserst weiches Metall. Es ist sehr dehnbar. Die reinste Form von Gold ist 24 Karat. Weniger rein ist 18 Karat und noch weniger 14 Karat. Goldene Dinge werden in der Regel nicht in 24 Karat hergestellt, weil es brechen würde. Es wäre zu weich. Eine Kette aus 14 Karat Gold ist viel stabiler als eine aus 24 Karat, weil sie einen grösseren Prozentsatz von Nichtgold-Legierungen enthält, die ihr Stärke geben.
Die Symbolik ist wie folgt. Der Aron stellt die Tora dar. Holz ist stabil und biegt sich nicht leicht. Der Grund, dass der Aron von innen aus Holz hergestellt wurde, ist, um zu betonen, dass wir nicht versuchen sollten, die Tora so zu formen, dass sie unseren Bedürfnissen entspricht. Reines Gold kann auf gewünschte Weise geformt und verbogen werden. Wir dürfen dies mit der Tora nicht tun. Leider gibt es verschiedene Bewegungen, welche versuchen, die Tora umzuformen. Wenn sie ihr Leben nicht der Tora anpassen ‘können’, versuchen sie, die Torah umzuformen, um sie ihrem Leben anzupassen. Die Tora will, dass wir dies vermeiden, und dies ist die Botschaft, die vom stabilen Holz im Innern des Arons zwischen den zwei Lagen von Gold gelehrt wird.
Auf ähnliche Weise sah ich einer Bemerkung von Rabbi Salman Sorotzkin sl. in seinem Hesped (Klagerede) auf den Brisker Raw. Raw Sorotzkin stellte die Frage: “Warum waren die Luchot HaEjdut (die Bundestafeln), die im heiligen Aron lagen, im Kodesch Kakodaschim (Allerheiligsten) hinter einem Vorhang aufbewahrt? Niemand sah je, den Aron Kodesch und schon gar nicht die Luchot, ausser einer Person, an einem Tag im Jahr. Nur der Kohen Gadol hatte am Jom Kippur die Gelegenheit, den Aron zu sehen! “Warum war dies so?” fragte er.
Raw Sorotzkin erklärte, dass die Tora sich in einer geschützten Kammer befand. Sie war nicht zugänglich, damit niemand versuchen würde, sich an ihr zu schaffen zu machen. Raw Sorotzkin verglich diesen Begriff mit dem Brisker Raw. Er lebte in Jeruschalajim in einem kleinen Haus und hatte nicht viel mit der restlichen Gesellschaft zu tun. Seine Aufgabe war es, der Beschützer der Tora zu sein. Er befand sich im Heiligtum mit der Tora. Er war unantastbar, so wie die Tora unantastbar sein muss.
Ein letztes Beispiel der Symbolik: Der Talmud in Joma (ibid.) verbindet die Tatsache, dass der Aron von aussen und innen vergoldet war, mit der Aussage, dass “jeder Talmid Chacham (Tora-Gelehrter), der von drinnen nicht gleich ist, wie er von draussen erscheint, kein Talmid Chacham ist”. Ein Mensch, der sich von draussen anders gibt, als er wirklich von drinnen ist, ist kein Talmid Chacham!
Hier eine Geschichte: Der Satmarer Rebbe sZl. kam nach dem Weltkrieg nach Amerika. Raw Schraga Feiwel Mendelovitz, der Rektor der Jeschiwa Tora Woda’at, lud den Rebben ein, in der Jeschiwa einen Tora-Schiur für die Talmidim zu geben. Der Satmarer Rebbe war ein aussergewöhnlicher Gelehrter. Er gab einen gut aufgenommenen Schiur, und wie es üblich war, umgaben ihn die Talmidim nach dem Schiur und besprachen verschiedene Punkte seines Vortrages mit ihm. Es gab bewegte Tora-Diskussionen, und es war eine wunderschöne Szene.
Raw Schraga Feiwel Mendelovitz hatte grosse Freude am Gespräch. Er war sehr stolz und lächelte vor Freude. Dies zeigte, dass es ihm gelungen war, eine Generation von jungen Tora-Studenten in Amerika zu erziehen, die fähig waren, einen Schiur des Satmarer Rebben zu hören und mit ihm einen ernsthaften Dialog über den Inhalt seines Vortrags zu führen.
Nachdem die Talmidim gegangen waren, wandte er sich dem Satmarer Rebben zu und sagte: “Nu, was halten Sie davon? War es nicht wunderschön?” Der Rebbe antwortete: “Ja, es war wirklich wunderschön, aber ich wünschte, dass diese jungen Männer von draussen mehr sein würden, als von drinnen (womit er den klassischen talmudischen Kommentar umkehrte, dass ein Talmid Chacham von drinnen sein sollte, wie er von draussen erscheint). In anderen Worten: er war beeindruckt, dass sie von drinnen wirklich feine Tora-Gelehrte waren; jedoch trugen sie keine Bärte und Pejot draussen, was der Satmarer Rebbe (gemäss seinen eigenen Bräuchen) als ein notwendiges Zeichen eines Talmid Chachams ansah.
Raschi, Akronym für Rabbi Schlomo ben Jizchak (1040-1105); Troyes (Frankreich) und Worms (Deutschland); „Vater aller TENACH- und Talmudkommentare“.
Rabbi Ja‘akov ben Ascher (1269 – 1343): Köln (Deutschland), Toledo (Spanien). Er war eine halachische Autorität des Mittelalters. Er verfasste berühmte Werke wie die “Arba’a Turim“(“vier Reihen”, da sein Werk vier Gesetzesabteilungen umfasst), oft nur mit dem Kürzel “Tur” genannt, eine der ersten kompletten jüdischen Gesetzessammlungen, die Basis unseres Schulchan Aruch’s (Gesetzbuch) von Rabbi Josef Karo. Seine Tora-Erklärung wird deshalb “Ba’al HaTurim“ (Meister der Turim) genannt.
Rabbi Schlomo Efrajim ben Aharon Luntschitz (1550 – 1619): Luntschitz (Polen), Lvov (Lemberg, Galizien, heute Ukraine), Prag (Tschechien). Talmud-Gelehrter, Rabbiner und geistiger Führer der Juden von Prag. Autor von vielen Werken, wie Olelot Efrajim, Siftej Da’at, Amudej Schesch, Ir Giborim und des klassischen Torahkommentars “Kli Jakar”.
Rabbi Chajim Josef David Asulai (1724 – 1806); bekannt mit dem Akronym “CHIDA“. Jerusalem, Chewron, Kairo und Livorno. Rabbiner, Kabbalist und Verfasser von über 80 Werken. War u.a. ein Schüler des Or Hachajim Hakadosch. Als ‘Schadar’ (Abgesandter) reiste er viel herum, um für die jüdische Gemeinde von Chewron (Hebron) Spenden zu sammeln. Einer seiner bekannten Werke ist Schem HaGedolim (Namen des Grossen), das über 1000 Biografien und Bibliografien von Weisen des jüdischen Volkes enthalten.
‘Pardes Josef’ von Rav Josef Patzenowski (gest. 1942 im Ghetto von Lodz); Pawianitz (Polen). Sein Werk ist eine Sammlung von klassischen Tora-Kommentaren. Zwischen 1930 und 1937 wurden drei Bänder seines Werkes (auf Bereschit, Schemot und Wajikra) gedruckt. Er starb im Ghetto, bevor er Zeit hatte, seine Manuskripte auf die Bücher Bamidbar und Dewarim dem Druck zu übergeben.
Rav Salman Sorotzkin (1881 – 1966): Rabbiner und Kämpfer für die jüdische Erziehung, Lutzk, Polen; Israel. Verfasser von diversen Werken, u.a. Sefer Osnajim le’Torah, Gedanken zum Chumasch.
Brisker Rav (1887 – 1959): Rav Jizchak Ze’ev (Welwel) Soloweitschik. Gelehrter und Rosch Jeschiwa, Nachfolger seines Vaters, Rav Chaijim Soloweitschik (1853-1918) in Brisk (Brest-Litovsk); floh im 2. Weltkrieg nach Israel.
Rabbi Joel ben Chananya Jom Tov Lipe Teitelbaum, Satmarer-Rebbe (auch genannt: Reb Joilisch), (1887-1979); geb. in Sighet (Königreich Ungarn, heute Rumänien). Sein Vater amtierte als Rabbiner von Sighet. Rabbi Joel war von früher Jugend an, für seine ausserordentlichen Geistesgaben bekannt. Bei seiner Bar Mizwa hielt er einen mehrstündigen Vortrag über ein Thema aus dem Traktat Schabbat. Im Jahr 1905 liess er sich in Satu Mare (Satmar) nieder, wo seine Anhänger, obwohl er noch so jung war, für ihn ein Bejt Midrasch eröffneten. Im Jahr 1911 wurde Rabbi Joel von der jüdischen Gemeinde der Stadt Irschawa eingeladen, als ihr Rabbiner zu amtieren, wo er anschliessend eine Jeschiwa gründete und im Sinne des Chassidismus sehr aktiv wirkte. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte er nach Satu Mare zurück.
Im März 1944 fiel die deutsche Armee in Ungarn ein. Am 3. Mai 1944 wurden die Juden Satmars deportiert. Baron Fülöp von Freudiger, Präsident der Budapester jüdischen Gemeinde, wählte 80 Rabbiner und andere prominente jüdische Persönlichkeiten und bezahlte für deren Aufnahme in die sogenannten Kastner-Transporte. Darunter war auch Rabbi Joel. Am 10. Juni erreichten sie Budapest, das sie am 30. Juni verliessen, dann aber am 9. Juli Richtung KZ Bergen-Belsen umgeleitet wurden. In den folgenden Monaten verhandelte Kastner mit Eichmann über ihre Freilassung. Im Lager lebten sie derweil unter erträglichen Bedingungen und erhielten auch ausreichend Nahrung. Rabbi Teitelbaum beachtete auch im Lager jedes kleinste Detail der Halacha und hatte eigene, koschere Nahrung mit auf den Weg genommen, die seine Frau für ihn zubereitete. Er ass nichts von den Mahlzeiten, die die anderen Gefangenen zugeteilt bekamen. Die Leiter der Gruppe befürchteten, dass die Bärte der Rabbiner die Wachmannschaften und Offiziere provozieren könnten, und baten die Rabbiner, sich ihre Bärte abzurasieren. Rabbi Teitelbaum wickelte sich ein Handtuch um den Kopf und gab vor, an Zahnschmerzen zu leiden.
Während eine erste Gruppe der Kastner-Gefangenen anfangs August freigelassen wurde, befand sich Rabbi Teitelbaum in der zweiten Gruppe, die Bergen-Belsen am 4. Dezember 1944 verliess. In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 1944 erreichte der Transport Kreuzlingen, in der neutralen Schweiz.
Im August 1945 verliess Rabbi Teitelbaum mit mehreren Hundert anderen Personen der Kastner-Transporte die Schweiz und wurde in Italien an Bord der “Ville d’Oran” nach Haifa eingeschifft, wo sie am Morgen des 2. September ankamen. Während seines Aufenthalts im britischen Mandatsgebiet lebte er in Jerusalem Er blieb dort ein Jahr, dann emigrierte der Satmarer Rebbe in die Vereinigten Staaten. An Rosch Haschana 1946 kam er in New York an und liess sich mit einer kleinen Zahl an Anhängern in Williamsburg, Brooklyn, nieder.
Er war der Gründer und erster Admor (Rabbi) der Satmarer Dynastie. Er leistete einen immensen Beitrag zur Renaissance des Nachkriegs-Chassidismus. Er war ein erbitterter Gegner des Zionismus. Allerdings war ausnahmslos jeder, der ihm begegnete, von seiner Klugheit, seiner Tora und seinem Chassidut begeistert. Er war einer der grössten Förderer von Wohltätigkeitsorganisationen nach dem Holocaust. Er selbst verteilte Unsummen an Bedürftige; er hatte für alle Wehklagenden ein offenes Ohr.
Seit den frühen 1960er-Jahren suchten seine Chassidim im Auftrag des Rebben nach einer geeigneten ländlichen Siedlung, wo sich das Chassidut abgeschieden von der Aussenwelt und ihren als schädlich empfundenen Einflüssen würde niederlassen können, und sie fanden schliesslich Land in Monroe, New York, wo sie Kiryat Joel errichteten. Die ersten Familien liessen sich dort im Jahr 1974 nieder.
Bei seinem Ableben wohnten über 100’000 Personen seiner Beerdigung in Kiryat Joel bei.
______________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
______________________________________________________________________________
Copyright © 2024 by Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.com und www.juefo.ch
Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.