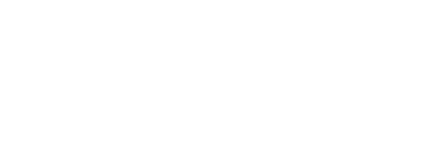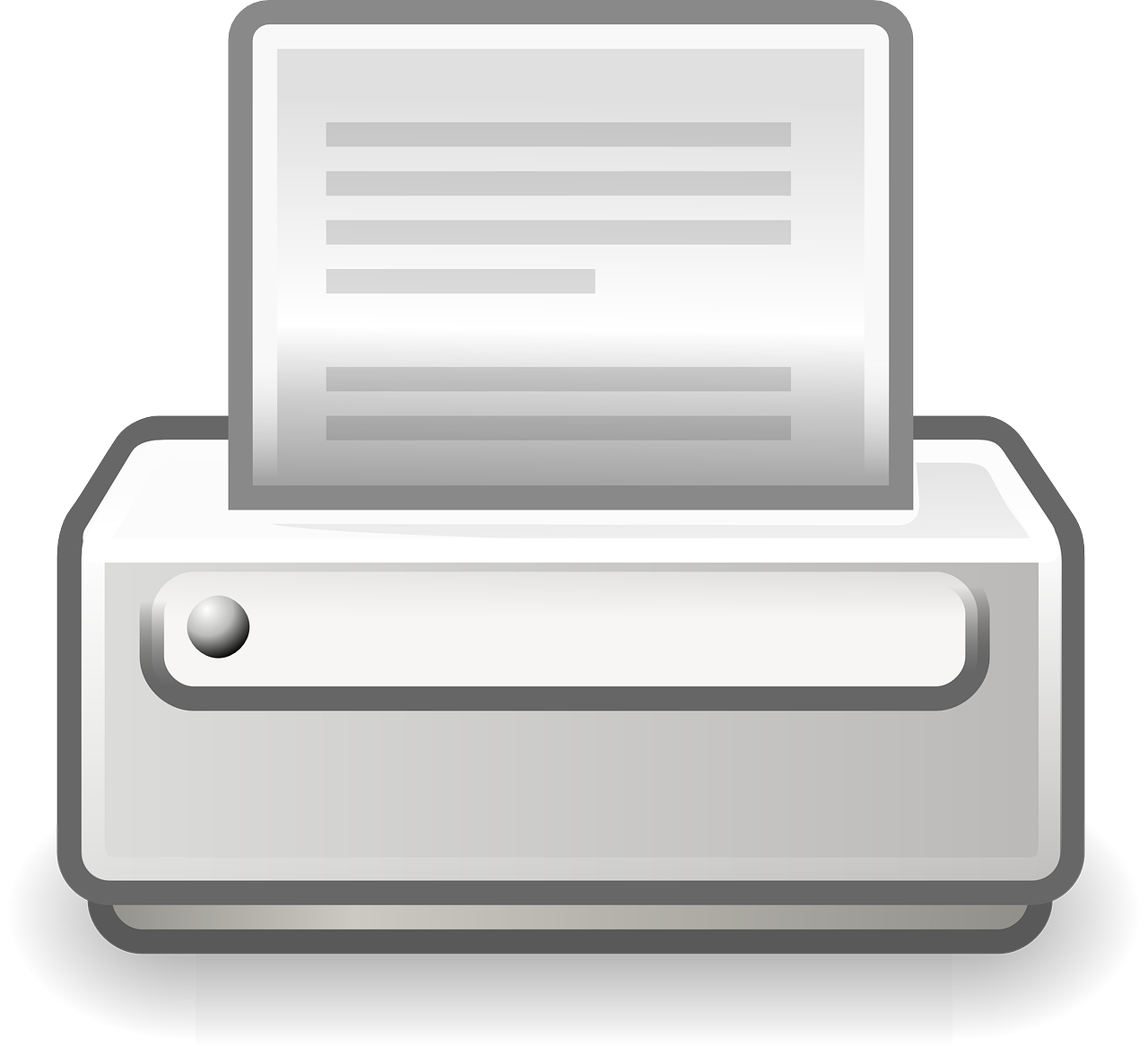Sukkot-Gedanken 5786 – von Rabbi Mosche Grylak
Juden, freut euch! Aber worüber?
Sukkot Gedanken, die heute mehr als je zuvor gelten!
Von Rabbi Mosche Grylak
Aus DJZ, Nr. 42/43, 14. Tischri 5769 / 13. Oktober 2008
mit Ergänzungen von S. Weinmann
Die Freude am Sukkot ist eine Mizwa für Arme und Reiche – die eigene Wohnung, die Villa und den sozialen Status zu verlassen, der den einen Jehudi von dem anderen unterscheidet, und eine Woche ausserhalb des üblichen, geldmässigen Rahmens zu leben.
Simcha ist eines der Gebote von Sukkot. "Das Fest der Sukkot (Hütten) sollst du sieben Tage feiern, wenn du den Ertrag deiner Tenne (Getreide auf der Dreschfläche, Getreidebündel) und deiner Kelter (Weinpresse) einsammelst. Freue dich, sei fröhlich an deinem Fest, du, dein Sohn, deine Tochter… (Dewarim 16: 13-15).
Dies erfordert eine Erklärung. Wie kann man jemandem befehlen, fröhlich zu sein? Kann eine Person einen solchen Befehl einfach so erfüllen? Freude ist ein Gefühl, es kommt nicht aus dem Nichts.
Zudem können wir fragen, warum uns besonders am Sukkot befohlen wird, uns zu freuen, und worüber wir uns genau freuen sollen. Darüber, dass wir in einer kleinen Hütte im Garten essen, statt in unserem Wohnzimmer?
Es gibt drei Worte im oben zitierten Passuk, die das falsche Verständnis der Mizwa bewirken können. Sie scheinen auf eine Art von Freude hinzudeuten, die die Tora im Sinn hat, zumindest in biblischen Zeiten. Diese Worte rufen ein Gefühl der Simcha hervor: "Be’ospecha miGornecha unmiJikwecha – wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter einsammelst." Die Tora befiehlt uns, im Herbst zur Erntezeit eine Sukka aufzustellen. Das war im biblischen Land Israel eine glückliche Zeit für die Juden. Es war die Jahreszeit, in der sie die Früchte der Arbeit des langen Sommers (und des vergangenen Winters) sahen. Die Getreidebündel standen zusammengebunden in einer Reihe wie Zelte auf ihrem Feld und liessen ihre Herzen vor Freude schwellen. Die langen, heissen Tage der Arbeit auf den Feldern waren vorüber, und ihre Getreidespeicher waren voll. Das war eine Zeit, um glücklich zu sein.
Aber ist das die Simcha, die die Tora meint? Das kann nicht sein. Denn die Tora befiehlt uns nie zu tun, was uns die Natur zwingt zu tun, weder als Individuen noch als Volk. Die Tora befiehlt uns zum Beispiel nicht, zu essen oder zu schlafen. Unsere Hormone befehlen uns auf Veranlassung der Hypophyse, diese Dinge zu tun, und wir gehorchen.
Eine Mizwa hat aber genau den gegenteiligen Zweck. Jede Mizwa, die im täglichen Leben ausgeführt wird, hat den Zweck, die natürlichen Triebe des Menschen zu begrenzen und zu läutern. Die Tora befiehlt dem Menschen nicht, zu arbeiten, aber sie setzt Grenzen für seine Arbeitsstunden, sie schreibt gewisse Zeiten vor, an denen er seinen Arbeitsprozess unterbrechen muss. Es gibt kein tägliches Gebot, zu essen, aber es gibt Gesetze, die das Essen einschränken und gewisse Nahrungsmittel verbieten.
Warum soll dann die Tora einer Person befehlen, fröhlich zu sein und in einem Fest zu schwelgen? Wer würde sich nicht freuen, wenn sein Getreidespeicher überfliesst und seine Weinpresse Kisten von Trauben zu Wein presst?
Wenn die Freude sich in einer solchen Zeit von selbst einstellt, was bezweckt die Tora dann, wenn sie uns die Mizwa gibt: "Du sollst dich an deinem Fest freuen"?
Es ist klar, dass die Simcha des Fests anders ist als Freude, die auf natürliche Weise entsteht. Durch das Fest wird Freude einer anderen Art geschaffen.
Was ist das grundlegende Konzept einer Sukka? Sie soll uns an unser nomadenartiges Leben in der Wüste erinnern. Um diese Erinnerung zu bewahren, ist es aber nicht nötig, eine Sukka gerade im Tischri zu bauen. Wenn wir sie im Tamus, Schewat oder Adar bauen, würde sie ebenso dazu dienen, diese historische Erinnerung in unseren Gedanken zu erhalten.
Dennoch wurde der Monat Tischri für diese Mizwa gewählt, weil Tischri tatsächlich die Erntezeit ist. Wenn wir "die Produkte von unserem Getreidespeicher und unserer Weinpresse sammeln", fühlen wir eine natürliche Woge der Freude, die nicht von der Tora gefordert wird, sondern im Gegenteil eher begrenzt werden muss. Ohne Begrenzung könnte dieser natürliche Jubel sich leicht in leere Fröhlichkeit und schliesslich in Übermut und Bitterkeit verwandeln. Aus diesem Grund wurde die Mizwa der Sukka dieser Jahreszeit zugeteilt und schafft so eine geistige Symbiose, die der Sukka eine religiöse und soziale Bedeutung gibt.
Die Erntezeit ist die perfekte Zeit, um dem Menschen zu befehlen, seine Wohnung – seine Festung – zu verlassen und eine Woche lang in einer vorübergehenden Unterkunft zu wohnen: "Damit die Herzen der kommenden Generationen in der Erntezeit nicht hochmütig werden, wenn ihre Häuser gefüllt sind mit guten Dingen. Sie sollen vielmehr an ihr ewiges Zuhause und an ihr Ende denken, um sich bewusst zu werden, dass diese Welt nur ein Gästehaus und eine vorübergehende Unterkunft ist." (Malbim, von Rabbi Meir Leibusch Weiser)
Es wird daher klar, dass es der Zweck der Sukka ist, den schädlichen Einfluss einzudämmen, der mit der Freude des Anhäufens von Besitz einhergeht. Die Sünde lauert zur Erntezeit am Scheunentor. Zusammen mit der Freude über die erfolgreiche Ernte kommt die Besitzgier.
Das Gefühl des Reichtums bringt mehr als eine Spur von Stolz mit sich. Dieser wiederum klopft dem Ego auf die Schulter und gratuliert ihm zur gutgetanen Arbeit. Und zur gleichen Zeit entwickelt sich, ohne dass der Mensch es überhaupt bemerkt, ein gewisses Gefühl der Geringschätzung und Überlegenheit gegenüber denen, die nicht so erfolgreich waren. Tief im Herzen, unsichtbar, wird der Samen für die Trennungen zwischen den Menschen gesät.
Aber das ist nicht alles. Die "Erntezeit" – oder jede Zeit, in der der Mensch sich von Erfolg gekrönt sieht – hat einen weiteren, bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeit. Erfolg bläht das Selbstbild des Menschen auf, die materiellen Leistungen werden dann eher zum Ziel als zum Mittel. Es wird unsichtbar ein weiterer schlechter Samen im Herz gesät, der Keim, der den Menschen dazu treibt, materiellen Reichtum um jeden Preis anzustreben, obwohl er wie der legendäre Sisyphus nie sein Ziel erreichen kann. Diese beiden Übel – das Herz von anderen Menschen abzuwenden und unaufhörlich materielle Güter anzustreben – sind die Hauptfeinde der Simcha, sie rauben dem Einzelnen und dem Klall (Gemeinschaft) das Glück.
Das ist die traurige Geschichte der Menschheit. Es ist nicht der Reichtum, sondern das Streben nach Reichtum, das den Hass zwischen dem Menschen und seinem Nächsten und Kriege zwischen Familien, Gesellschaften und Völkern verursacht hat und jede Spur von Glück und Freude aus dem Gesicht des Menschen entfernt.
Der hohe Stellenwert der sozialen Leistungen hat unsere ganze Erde in einen Jagdgrund verwandelt, auf dem das Unerreichbare angestrebt wird. Was immer erreicht wird, kann man nicht geniessen, weil irgendjemand mehr erreicht hat.
Genau wenn diese menschliche Tendenz am stärksten erwacht, genau zur Erntezeit, befiehlt uns die Tora deshalb die Mizwa der Sukka. Sie führt uns aus dem Konkurrenzkampf hinaus, hilft uns, unsere Neigung, unser Leben mit flüchtigem Streben zu verbringen, zu mässigen, und stellt wieder ein geistiges Gleichgewicht zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft her – wegen der Simcha.
Freude am Sukkot ist eine Mizwa für die Armen und für die Reichen – die eigene Wohnung und den sozialen Status zu verlassen, der den einen vom anderen unterscheidet, und eine Woche ausserhalb des üblichen, geldmässigen Rahmens zu leben. Gleichwertig in zerbrechlichen Strukturen zu leben und die Sterne des Himmels durch das Blätterdach zu sehen, das weder den Regen noch die Sonne fernhält. Eine Woche der Gleichheit, inspiriert von einem Sinn von Vergänglichkeit, die einen neuen, gesünderen Blick auf den Besitz gibt, der im Haus zurückgelassen wurde.
Jeder Jude weiss, dass das ganze Volk jetzt in Sukkot sitzt, ausserhalb ihrer normalen Wohnungen, und dieses Wissen verstärkt das Vergnügen der Brüderlichkeit und Gleichheit. Diese vorübergehende Loslösung von der Bequemlichkeit des Hauses, dieser Sinn von Vergänglichkeit und Minimalismus erinnern an den vorübergehenden Charakter dieser ganzen Welt. Das Gefühl der falschen Sicherheit des Besitzes wird beseitigt. Der Drang, Reichtum und alles, was dazu gehört, zu erlangen, wird etwas reduziert, und durch den Riss in der Wand des Materialismus erhält der Mensch wieder einen flüchtigen Blick auf seinen Nachbarn.
"Das ist die besondere Bedeutung dieses Fests, wir gehen in unsere kleine Sukka ohne Vorräte, nur mit den Mahlzeiten für jeden Tag und mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl und einer Lampe. Das ist eine wunderbare Art, um die Seele zu erwecken, sich nicht mit den materiellen Angelegenheiten zu beschäftigen, denn diese elementaren Dinge genügen."
"Die Minimalgrösse der Sukka", die in der Länge und Breite sieben Tefachim (rund 60-70 cm) und zehn (ca. 90-100 cm) in der Höhe beträgt, bedeutet ein Leben der Zufriedenheit mit dem Minimum. "Beschränke dich auf das Notwendige und strebe keine grossen Dinge an, denn wenn du dich an diese bescheidene Lebensweise gewöhnst, wirst du nicht Mehr wollen."
"Aber wenn du dir Luxus leistest, wirst du mit nichts zufrieden sein" ("Akejdat Jizchak" von Rabbi Jizchak Arama).
Das ist es! Brüderlichkeit, Gleichheit, Einfachheit und Protest gegen den Luxus: das sind die Geheimnisse der Sukka. Sie halten die Zügel der grenzenlosen Freude über den eigenen Reichtum und lehren uns, das zu geniessen, was wir haben.
Wenn ein Mensch nicht nur weiss, was er machen soll, sondern was er sein soll, wird er die Simcha erreichen, von der die Tora spricht. Dann wird er den Unterschied erkennen zwischen der wahren Freude und dem reinen Jubel über die Ernte, die am Schluss erfahrungsgemäss zu Traurigkeit führt.
Jehi Sichro Baruch – Möge sein Andenken zum Segen sein.
Quellen und Persönlichkeiten
"Akejdat Jizchak" (auch Ba’al Akejda genannt) von Rabbi Jizchak ben Mosche Arama (1420-1494). Spanischer Gelehrter. Zamora, Tarragona, Aragon, Calatayud (Spanien). Einer der grossen Erklärer des Mittelalters. Er zog nach der Vertreibung von 1492 nach Neapel und verschied dort. Schrieb berühmten philosophischen Kommentar auf die Tora, wie auch auf die fünf Megillot, etc.
"Malbim" von Rabbi Meir Leibusch ben Jechiel Michael Weiser (1809-1879); Wreschen und Kempen (Polen), Bukarest (Rumänien). Bekannt mit dem Akronym "MALBIM". Er war ein bedeutender Rabbiner und Talmudist, Possek und Kabbalist, Bibelkommentator und Darschan (Prediger). Seine Bibelkommentare gehören zu den umfangreichsten und populärsten Werken zu TENACH. Er schrieb viele weitere Werke. Er war ein streitbarer Gegner der Reform und litt deshalb sehr viel von Verfolgungen und Verleumdungen.
Rabbi Mosche Chajim Grylak (1936-2023). Belgien, Frankreich, Schweiz, Israel. Er war eine führende Persönlichkeit der Teschuwa-Bewegung, Chefredakteur des berühmten Mishpacha-Magazins und respektierter Schriftsteller.
Rabbi Grylak wurde in Antwerpen, Belgien, als Sohn von Rabbi Eliyahu Grylak geboren. Er erhielt den Namen Mosche Chajim nach dem Ramchal. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs floh er mit seiner Familie nach Frankreich und lebte unter der Vichy-Herrschaft getarnt als Nichtjude. Im Jahr 1942, im Alter von nur 6 Jahren überquerte er allein mit drei anderen Kindern die Grenze in die Schweiz, wo er bis zum Ende des Krieges bei Adoptiveltern aufwuchs.
1945 wieder mit seinen Eltern vereint, wanderte er nach Israel aus. Er studierte in den Jeschiwot Kol Tora und Poniwesch und lernte gemeinsam mit dem ehemaligen Oberrabbiner Jisrael Meir Lau. Rabbi Grylak diente eine Zeitlang in der IDF, später als Reservist in der Luftwaffe und kämpfte im Jom-Kippur-Krieg.
Danach wurde er einer der Pioniere und Führer der Teschuwa-Bewegung und Gründungsmitglied einer der grössten Teschuwa-Organisationen "Arachim". Seine journalistische Karriere begann er mit Beiträgen über die Parascha für die Maariv-Zeitung (einer der populärsten Zeitungen damals).
Später war er einer der Gründer der israelischen Zeitung Yated Ne’eman und mehrere Jahre als Chefredakteur tätig. In den 1990er Jahren wurde er Chefredakteur des berühmten Mischpacha-Magazins. Rabbi Grylak veröffentlichte auch eine Reihe von Büchern, darunter einige unter einem Pseudonym, Chaim Eliav; diese wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Er war einer der bekanntesten charedischen Journalisten und Redner.
Im Jahr 1998 war er in Zürich zu Gast, wo er - anlässlich der Gründung der Kiruv-Organisation Lema’an Achai (Jüfo-Zentrum) in der Schweiz - mehrere inspirierende Vorträge hielt.
Nach der Heirat lebte er jahrelang in Tel Aviv. In den 1990er Jahren liess er sich im Stadtteil Har Nof in Jerusalem nieder. Von allen Schattierungen hochgeschätzt und beliebt verstarb er dort im Alter von 87 Jahren. Jehi Sichro Baruch.
______________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
______________________________________________________________________________
Copyright © 2025 by Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com
Weiterverteilung ist erlaubt, jedoch nur unter korrekter Angabe der Urheber und des Copyrights von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich steht Ihnen für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum gerne zur Verfügung: info@juefo.com