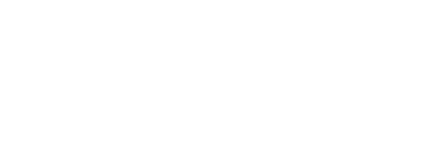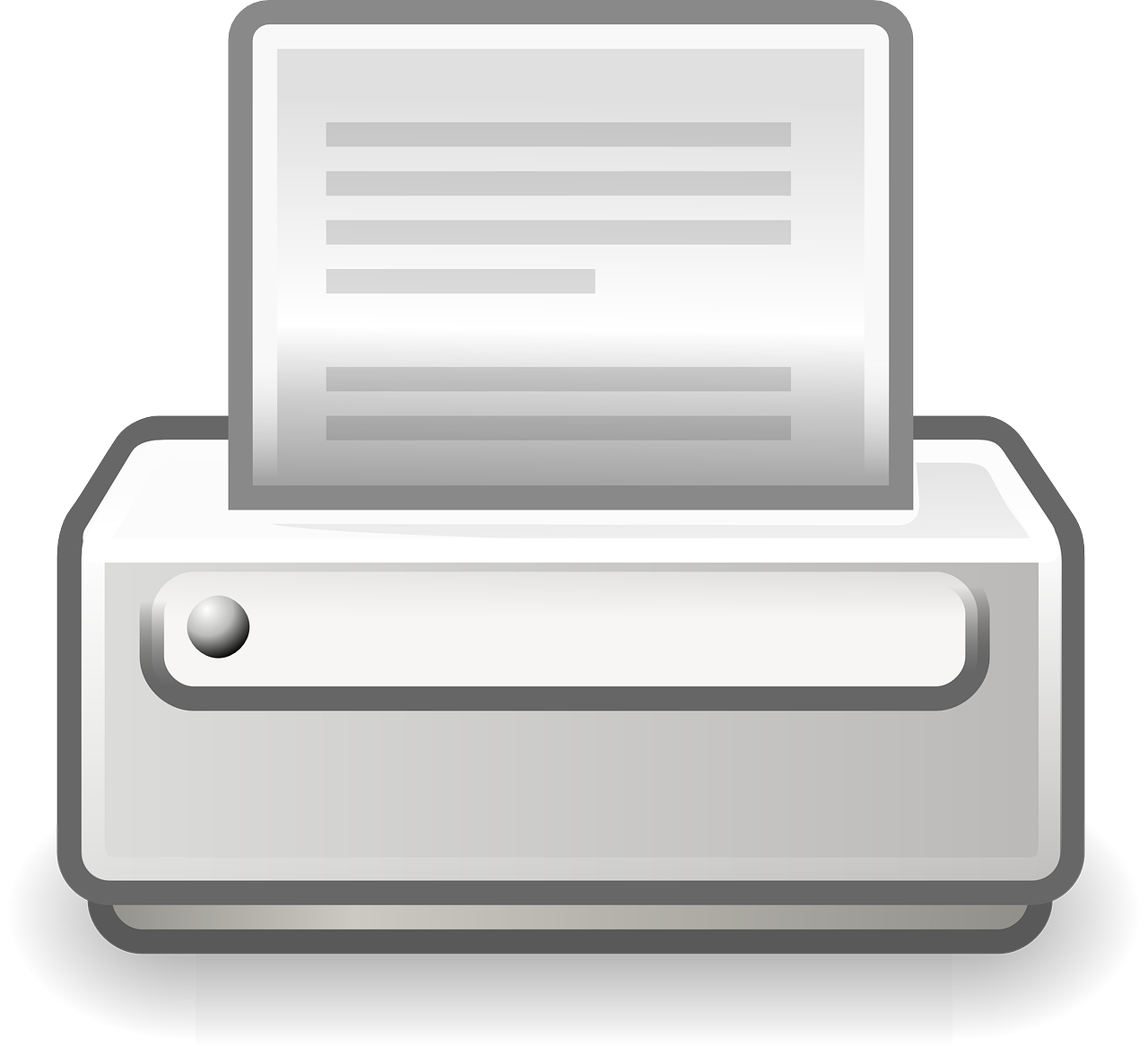Ein Hoffnungsschimmer
Rabbi Dovid Kaplan zu Jom Kippur 5786
Aus DJZ, Nr. 38, 9. Sept. 2007 / 9. Tischri 5768 mit Ergänzungen von S. Weinmann
Während Jom Kippur näherkommt, denkt jeder an Teschuwa. Ein wenig Seelenforschung, etwas Reue und die Absicht, sich in der Zukunft besser zu verhalten, sind zu diesem Zeitpunkt sicherlich angebracht. Denn der Din, der Gerichtentscheid, ist immer noch ungewiss, und alle möchten gerne mit einem positiven Urteil daraus hervorgehen.
Die Gemara [Traktat Baba Mezia 85a] erzählt uns über eine schwere Zeit im Leben von Rabbi Jehuda Hanassi (der Fürst), der unter dem Namen "Rebbi" bekannt ist. Während dreizehn Jahren litt Rebbi unter furchtbaren Schmerzen, teils wegen eines Zahnleidens, teils wegen eines Nierensteins. Das sind die beiden schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch erleiden kann, und Rebbi hatte diese während einer solch langen Zeit ununterbrochen. Was hatte er getan, um solch ein Leid zu verdienen? Wurde er dazu benützt, um für seine Generation zu sühnen? Waren dies "Jissurim schel Ahawa (Leiden der zusätzlichen Läuterung bei Zadikkim)" oder etwas anderes?
Der Talmud erzählt: "Rebbi wurde für einen Mangel an Mitgefühl bestraft, das man eigentlich von ihm erwartet hätte. Solch ein Minuspunkt wäre bei irgendeinem von uns wohl kaum bemerkt worden. Rebbi aber war kein gewöhnlicher Mensch. Daher wurde er äusserst genau bewertet. Was war geschehen? Ein Kalb wurde ins Schlachthaus gebracht. Obwohl die Schechita (Schächten) bekanntlich schmerzlos ist, hatte das Kalb es vorgezogen, weiter am Leben zu bleiben. Daher lief es zu Rebbi und versteckte sein Kopf unter dem Gewand von Rebbi und "weinte" und deutete mit dieser Geste an, dass Rebbi es doch retten sollte.
Rebbi reagierte mit einem einzigen Satz: "Geh", sagte er, "dazu wurdest du erschaffen." Das war es. Der Vorfall war damit abgeschlossen. Nur ein Satz! Für die Madrega (geistige Stufe), auf der Rebbi sich befand, wurde er aber als unpassend bewertet. [Anmerkung des Herausgebers: Der Maharscha zur Stelle erklärt, dass die meisten Kälber zur Arbeit gebraucht werden, und eher die älteren Ochsen, die keine Arbeit mehr verrichten können, zum Schächten da sind]
Die Gemara beschreibt dann die Qualen, die Rebbi in den folgenden Jahren durchzustehen hatte.
Nach dreizehn Jahren fegte seine Magd eines Tages das Haus und stiess dabei auf einige kleine Nagetiere. Sie wollte diese hinausfegen, doch hinderte Rebbi sie daran und sprach: "In [Tehilim/Psalm 145:9] steht, …und Sein Erbarmen ist über all Seine Geschöpfe. Lass sie in Ruhe". Im Himmel wurde in jenem Moment beschlossen, dass Rebbi wegen seiner Barmherzigkeit ebenfalls Gnade erhalten und sein Leid ein Ende haben sollte.
Denken wir einen Augenblick darüber nach. Dreizehn Elul-Monate kamen und gingen. Wir können sicher sein, dass Rebbi diese für die bestmögliche Teschuwa (Rückkehr) und Ahawat Haschem (G-ttesliebe) nutzte. Dreizehn Mal vergingen Rosch Haschana und Jom Kippur, mit unvorstellbaren Tefillot (Gebeten). Dennoch konnte nichts von alldem ihn von den grausamen Schmerzen befreien. Es brauchte eine konkrete, barmherzige Tat, die sich auf ein scheinbar unbedeutendes Geschöpf bezog, um seine Erlösung zu erreichen.
Chasal (unsere Weisen) bringen ein Beispiel, das diesen Gedanken erfasst. "Wer mit den Geschöpfen barmherzig ist, wird auch vom Himmel Gnade erhalten [Talmud Traktat Schabbat 151b]." Geschöpfe, mit dem sind natürlich auch die zu uns nahestehenden Menschen gemeint, wie zum Beispiel Familienmitglieder und Schüler. Nicht nur Fremde oder flüchtige Bekannte sollten auf der Empfängerseite unserer aus Barmherzigkeit motivierten Taten stehen, sondern zuallererst unsere Nächsten und Liebsten.
So oft verletzen wir Kinder und Schüler – ungerechtfertigt – durch Worte. Natürlich nicht immer. Manchmal müssen wir sie streng zurechtweisen. Doch kommt es immer wieder vor, dass es falsch läuft. Verdient ein Dreijähriger zum Beispiel wirklich, dass man ihn anfährt, nur weil man einen anstrengenden Tag hinter sich hat? Kann man einen Schüler nicht auch einmal unbestraft lassen, statt diesen strikt im Namen eines Prinzips zu strafen? Hier fallen jedem wahrscheinlich genügend Beispiele ein.
Es wäre gut für jeden Menschen (mit Ausnahme von Müttern mit Babys und Kleinkindern), irgendwann vor dem Jom Hadin (Tag des Gerichts) einige ruhige Augenblicke zu finden, um über die Behandlung der Mitmenschen nachzudenken.
Bei Ansprachen, die ich kürzlich in der Jeschiwa und im Seminar hielt, erklärte ich den Schülern, dass sie, falls sie wirklich wissen möchten, welche ihrer Missetaten "Bejn Adam LeChawero" (zwischenmenschliche Beziehungen) verbessert werden müssten, sie ihre Zimmergenossen fragen sollten. Welch interessante Informationen werden sie dabei erhalten! Sie werden zum Beispiel erfahren, wen sie durch nächtlichen Lärm alles gestört haben, wen es irritierte, dass sie auf seinem Bett sassen, wen sie durch den Gebrauch von "harmlosen" Spitznamen beleidigten und wer keine Streiche schätzt.
Eltern und Lehrer könnten und sollten dasselbe tun. Befragen Sie ihre "Mitbewohner", um festzustellen, wie diese Ihr Verhalten beurteilen. Und machen Sie es ihnen leicht! Fordern Sie sie auf, offen und ehrlich zu sein und unterbrechen Sie sie nicht, indem Sie sich verteidigen. Akzeptieren Sie wie ein "reifer Erwachsener", was sie sagen. Und denken Sie darüber nach. Wenn irgendetwas daran wahr ist, dann gehen Sie darauf ein.
All dies bringt uns zum nächsten Punkt, der stark damit zusammenhängt. Chasal sprechen von einem "Ma’awir al Midotaw" - einem Menschen, der "seine Eigenschaften überwindet". Das bedeutet, dass man grundsätzlich gewillt ist, das Schlechte, was einem angetan wird, zu übersehen, ohne aus den verschiedenen Bagatellen grosses Aufsehen zu machen, seien diese nun recht oder nur eingebildet. Beispiele dafür finden wir in unserem Leben täglich. Egal, wie schwierig es ist, lohnt es sich, diese Eigenschaft anzuwenden.
Warum? Chasal nennen den Grund: "Wer das Schlechte, das ihm angetan wird, übersieht, dessen Missetaten werden ebenfalls übersehen." [Im Talmud Traktat Rosch Haschana [17a] sagt Rawa: "Kol haMa’awir al Midotaw, ma’awirin lo al kol Pescha’aw" – wer auf "Vergeltung/Gleiches mit Gleichem" verzichtet, den vergibt man alle seine Sünden".]
Wichtig ist aber: Ein Mensch kann seine Elul-Arbeit mangelhaft ausgeführt haben, sodass er nicht alle seine Awerot (Verfehlungen) korrigiert hat. Wenn es ihm aber gelingt, seine Middot zu überwinden, werden auch all diese Awerot von G"tt "übersehen" werden. Hakadosch Baruch Hu verhält sich "Midda keneged Midda" (Mass um Mass).
Rabbejnu Jona bezieht sich in seinem Werk Scha’arej Teschuwa auf dieses Prinzip, das er als "wunderbaren Hoffnungsschimmer" bezeichnet, mit dem man den Jom Hadin beginnen kann.
Wenn also kein Handtuch mehr neben dem Waschbecken hängt, weil die letzte Person es nicht ersetzte, dann lohnt es sich nicht, deswegen ein grosses Theater zu machen. Wenn einige Lichter im Haus nicht gelöscht wurden, denken Sie zweimal nach, bevor Sie ungemütlich werden.
Wenn jemand auf deinem Bett sitzt oder etwas ohne deine Erlaubnis benützt, raste nicht gleich aus. In solchen und anderen Fällen steht ganz einfach zu viel auf dem Spiel.
Hier eine Geschichte, mit der wir gut ausgerüstet Jom Kippur entgegen gehen können.
Ein Ehepaar war viele Jahre lang kinderlos. Jedes Jahr ging der Mann zu Raw Chajim Kanievsky sZl., um eine Beracha (Segen) zu erhalten, leider ohne Erfolg. Schliesslich sagte Raw Chajim ihm eines Tages, dass es einen Hoffnungsschimmer gebe. Er müsse jemanden finden, der beleidigt oder angeschrien wurde und darauf nicht reagierte ("Hane'elawim we'enam olwim"), und solle anschliessend von diesem Menschen eine Beracha verlangen.
[Anmerkung des Herausgebers: Der Ausdruck „Hane’elavim we’enam olwim“ stammt aus der Gemara [Traktat Joma 23a und Schabbat 88b], wo es heisst, dass jene, die sich beschimpfen lassen, aber nicht zurückschimpfen; die hören, wie man sie beleidigt, aber nicht antworten – sondern geduldig und still bleiben – die den Willen G-ttes aus Liebe erfüllen und sich mit den Leiden, die über sie kommen (wie z.B. Beleidigungen) freuen, über sie sagt die Schrift [Schoftim 5:31]: „Die ihn lieben wie die Sonne, die in ihrer Kraft aufgeht.“Das ist also nicht Schwäche, sondern eine ungeheure innere Stärke. Nicht Reaktion aus dem Ego heraus, sondern Demut, Bescheidenheit und Zurückhaltung. Einige Kommentatoren erklären den Vergleich mit der Sonne so (kurzgefasst): Am Anfang der Schöpfung waren beide Lichtkörper Sonne und Monde gleich gross. Der Mond reklamierte und war damit nicht einverstanden. Die Sonne schwieg. Die Auswirkung davon war, dass der Mond verkleinert wurde, hingegen die Sonne in ihrer Grösse und Stärke blieb. Siehe Traktat Chulin 60b.]
"Vielleicht", sagte Raw Chajim, "wird dir daraus eine 'Jeschua' (Rettung) entstehen."
Der Mann ging, um jemanden zu suchen, der beleidigt wurde. Das war aber gar nicht einfach. Er versuchte es in Synagogen, bei Bushaltestellen, in Festsälen und so weiter. Kein Glück. Einige Monate vergingen ereignislos. Ausgerechnet dann, wenn man jemanden sucht, der schlechte Charaktereigenschaften aufweist, findet man niemanden. Er hörte allmählich mit der Suche auf und hatte das Ganze schon beinahe vergessen. Eines Abends bemerkte er bei einer Hochzeit aber einen Rummel. Jemand stand da und schrie einen anderen Mann an, der ruhig dasass und weiter ass.
"Du Tunichtgut", schrie der Mann. "Ich will mein Geld zurück und werde dir niemals verzeihen." Er überhäufte ihn mit Beleidigungen und schimpfte immer weiter. Unser Mann merkte plötzlich, dass dies hier eine einmalige Gelegenheit für ihn war, doch befürchtete er, dass der Angegriffene in einem gewissen Moment seine Geduld verlieren könnte. Er eilte zu ihm hinüber.
"Antworten Sie bitte nicht", flehte er ihn an. "Was auch immer Sie tun möchten, aber antworten Sie nicht! Bitte, bitte!" Der Schreiende, dessen Anschuldigungen, wie sich nachhinein herausstellte, völlig ungerechtfertigt waren, drehte sich plötzlich um und ging weg.
"Bitte geben Sie mir eine Beracha", bat der Ehemann denjenigen, der nicht reagiert hatte. "Raw Chajim Kanievsky hat mich zu Ihnen geschickt.
Zehn Monate später kam sein Sohn zur Welt.
Glossar:
Teschuwa:
Der hebräische Begriff Teschuwa kommt vom Ausdruck «Schuw-Zurückkehren» und bedeutet die Umkehr zum Ewigen. Es geht um das menschliche Bemühen um Wiedergutmachung der Folgen früherer Taten, Verfehlungen und Sünden.
Die Teschuwa besteht aus fünf Elementen:
- Hakarat haChet – Das Erkennen der Sünde
- Asiwat HaChet - Das Ablassen der Sünde
- Charata - Das Bereuen der Sünde
- Widuj - Das Sündenbekenntnis
- Kabala leAtid - Der Entschluss, die Sünde nie zu wiederholen
"Jissurim schel Ahawa":
(Schmerz/Leid aus Liebe): Unsere Weisen sagen im Talmud Traktat Berachot [5a]: Wenn ein Mensch sieht, dass Leiden über ihn kommen, so soll er seine Taten kontrollieren… Wenn er aber schlussendlich sieht, dass er nicht gesündigt hat und dennoch leidet, so sind dies gewiss "Jissurim schel Ahawa" - Leid aus G-ttes Liebe/Güte zu ihm. Es gibt einige Wege dies zu erklären. Wir bringen hier die Erklärung des "Zelach" (Rabbi Jecheskel Landau von Prag) gestützt auf Raschi zur Stelle. Raschi erklärt: G-tt lässt ihn auf dieser Welt leiden, ohne dass er gesündigt hat, um seinen Lohn auf der anderen Welt zu vergrössern. Die Frage stellt sich, wo steht, dass der Ewige für Leiden Lohn gibt? Erklärt der "Zelach" folgendes: In Pirkej Awot (Sprüche der Väter) [5:23] heisst es: Ben Hej Hej sagt: "Lefum Za’aro Agro" – Nach Verhältnis der Mühe und Anstrengung ist der Lohn. Das bedeutet, dass der Lohn nicht nur für die Tat allein, sondern im Verhältnis zum Einsatz und der Anstrengung bei der Ausübung der guten Tat, gegeben wird. Deshalb, wenn ein Mensch leidet und dennoch mit grosser Anstrengung und Mühe die Mizwot erfüllt, vergrössert sich sein Lohn auf der künftigen Welt um ein Vielfaches.
Quellen und Persönlichkeiten:
Raschi, Akronym für Rabbi Schlomo ben Jizchak (1040-1105); Troyes (Frankreich) und Worms (Deutschland); „Vater aller TENACH- und Talmudkommentare“.
Rabbejnu Jona ben Abraham Gerondi (1200-1263); Girona, Barcelona und Toledo, Spanien. Rabbiner und Rosch Jeschiwa. War einer der bekannten Rischonim. Cousin des Ramban (Nachmanides). Bekannt durch seine Werke: „Scha’arej Teschuwa (Lehre über moralisches Verhalten)“, Erklärungen zu Pirkej Awot und Mischlej, wie Abhandlungen zum Talmud (grosser Teil ging verloren).
Maharscha: Akronym von Rabbi Schmuel Elieser Halevi Edels (1555-1631). Seine Mutter war eine Cousine des berühmten Maharal von Prag. Bedeutender Talmudkommentator. Seine Talmudkommentare gehören zu den Klassikern der talmudischen Literatur, geniessen grosses Ansehen und sind in fast allen Talmudausgaben enthalten. Rabbiner in Chelm (bei Lublin), dann in Lublin (Polen) und schlussendlich in Ostraha (Ostrog, Polen heute Ukraine), wo er eine grosse Jeschiwa gründete.
Rabbi Schemarjahu Josef Chajim Kanievsky (1928-2022); geb. in Pinsk (Polen, heute Weissrussland); Benej Berak, Israel. Er war einer der grössten zeitgenössischen Tora-Gelehrten. Er war der Sohn des berühmten Rabbi Ja’akow Jisrael Kanievsky (bekannt als der „Steipler“). Er kam im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in das britische Mandatsgebiet Palästina und verliess das Land seither nicht mehr. In seiner Jugend galt er als Wunderkind, das sich mit einem fotografischen Gedächtnis an die Texte der Tora und Talmud erinnern und trotz seines jungen Alters komplizierte rabbinische Lehren erklären konnte.
Er studierte bei seinem Vater und in der Jeschiwat Lomza in Petach Tikwa. Er war einer der herausragenden Führer des orthodoxen Judentums in und ausserhalb Israels. Er erhielt jedes Jahr Tausende von Besuchen von Juden, die in jeglichen Gebieten der Tora und Halacha, oder Gesundheitsfragen Rat suchten, oder einen Segen erhalten wollten. Viele wurden von seinem Segen oder Rat geholfen. Unzählige wunderliche Geschichten werden von vielen Geholfenen erzählt. Rabbi Kanievsky war Präsident unzähliger Bildungseinrichtungen und Wohltätigkeitsorganisationen.
Sein Tagesprogramm war unfassbar! Über ein Dutzend Schiurim hatte er täglich, wie z.B.: 8 Blatt (8x2 Seiten) Talmud Bawli, 8 Blatt Talmud Jeruschalmi, Sohar 11 Blatt, Tanach 8 Abschnitte, Rambam 8 Abschnitte, Schulchan Aruch 10 Abschnitte, Midraschim 8 Abschnitte, Schriften des Ari Hakadosch 8 Blatt, etc. Rabbi Kanievsky verfasste zahlreiche Werke. Jedes Jahr wurden ihm Tausende Briefe mit Fragen zu allen Themenbereichen geschickt, die für die Tora von Interesse waren. Seine Antworten sind meist sehr kurz und bestehen oft aus wenigen Worten. Aus seinen schriftlichen und mündlichen Antworten ist eine umfangreiche Literatur entstanden. Etwa hundert Bücher enthalten einen Teil seiner Antworten auf die Fragen der Autoren. Mehr als einmal wurde festgestellt, dass er sich beim Schreiben seiner eigenen Werke verzögerte, weil er die Antworten auf die vielen Fragen schrieb.
Die Zahl der Trauergäste bei dem Begräbniszug am 20. März 2022 rund um den Friedhof Sichron Meir in Benej Berak, wurde auf ca. 400’000 bis 750’000 geschätzt.
______________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
______________________________________________________________________________
Copyright © 2025 by Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com
Weiterverteilung ist erlaubt, jedoch nur unter korrekter Angabe der Urheber und des Copyrights von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich steht Ihnen für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum gerne zur Verfügung: info@juefo.com