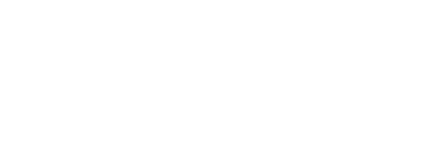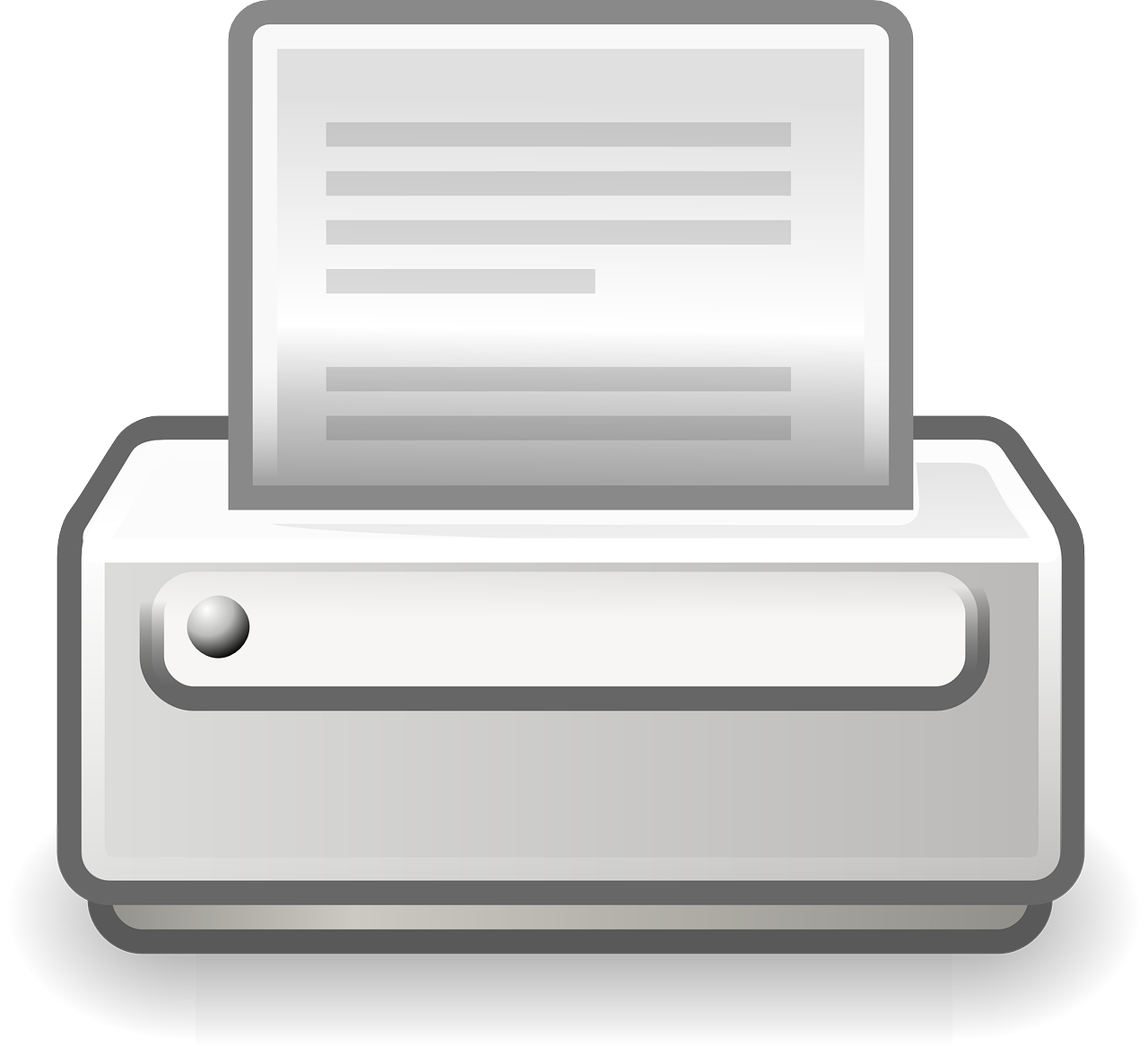Der Chafez Chajim zu seinem Sohn: Sogar du kannst den G’ttlichen Namen entweihen
Raw Frand zu Parschat Emor 5785
Der Rambam (Maimonides) beschreibt in seinem Sefer HaMizwot (Verbot Nr. 63) die drei Bereiche, welche zum Gebot der Heiligung und der Entweihung des G'ttlichen Namens gehören: "Und du sollst Meinen Heiligen Namen nicht geringschätzig behandeln" [Wajikra 22:32].
Die Sünde besteht aus folgenden drei Bereichen: (1) Jemand, der gezwungen wird, eines der Gebote zu übertreten, für die gefordert wird "Lass dich eher töten, als das Gebot zu übertreten"; (2) ein Mensch, der ein Gebot nicht deshalb übertritt, weil es ihm Freude bereitet oder weil er einen Nutzen daraus zieht, sondern nur darum, weil er sich (geistig) auflehnen und die Himmlische Herrschaft abwerfen will; (3) ein Mensch, der als fromm angesehen wird, begeht eine Handlung, die für die Gesellschaft eine Sünde zu sein scheint. Sogar wenn diese Handlung grundsätzlich erlaubt ist, kann sie zur Entweihung des G'ttlichen Namens (Chillul HaSchem) führen.
Die dritte Kategorie spricht von einem Rabbi, einem Talmid Chacham (Toragelehrten) oder einer angesehenen Person, die eine Handlung begeht, welche ohne weiteres erlaubt ist, die aber andere Menschen nicht von ihm erwarten. Hätte jemand anderer das Gleiche getan, würde niemand auch nur mit der Wimper zucken oder einen Gedanken daran verschwenden. Aber für eine Persönlichkeit dieses Kalibers ist es ein Chillul Haschem.
In seiner Rechtslehre wird der Rambam noch deutlicher [Mischne Tora, Jesode HaTora 5:11]: "Falls eine grosse Tora - Autorität, also jemand, der für seine Frömmigkeit bekannt ist, etwas tut, das die Menschen zur "Üblen Nachrede über ihn" bringt ("meranenim acharaw"), bewirkt er damit - obwohl dies eigentlich keine Sünde ist – eine Entweihung des G'ttlichen Namens (was eine furchtbare Sünde ist)."
Der Chafez Chajim schickte einmal seinen Sohn auf die Reise. Der Chafez Chajim mahnte ihn, auf sein Benehmen achtzugeben. Benähme er sich nur ein wenig anders, als es sich für einen Toragelehrten gebührt ("es passt nischt"), würde er eine Entweihung des G'ttlichen Namens bewirken. Rav Pam erzählt, dass der Sohn des Chafez Chajim seinen Vater fragte: "Aber bin ich denn ein Talmid Chacham? Ich gehöre doch bestimmt nicht in die Gruppe von Menschen, von der der Rambam schreibt: " eine grosse Tora-Autorität, jemand, der für seine Frömmigkeit bekannt ist …" Ich bin ein einfacher Jude." Darauf antwortete der Chafez Chajim: "Du bist ein genügend grosser Talmid Chacham, um eine Entweihung des g’ttlichen Namens zu bewirken."
Ich möchte gern eine Halacha paskenen (einen jüdischen Rechtsentscheid treffen). Jeder, der als religiöser Jude erkennbar ist, hat heute den Status eines Talmid Chacham, wenn wir uns auf die dritte Kategorie von Chillul Haschem, gemäss dem Rambam, beziehen. Jeder Mensch, mit dem Sie in Kontakt kommen, betrachtet Sie als "Rabbi", "Toragelehrten" oder "angesehene Person", wenn es auch „nur“ die Verkäuferin im Supermarkt oder der Mann von der Tankstelle ist. Heutzutage wird jeder religiöse Jude von der Umgebung als "Rabbi" angesehen.
Ein solcher Titel ist kein Zuckerschlecken. Er bringt eine gewaltige Verantwortung mit sich. Theoretisch gehört nicht jeder Jude in diese dritte Kategorie gemäss des Rambams Aufzählung. Zu Rambams Zeiten wussten die Menschen, dass es Persönlichkeiten wie den Rambam gab und daneben gewöhnlich Sterbliche. Deshalb konnte der Rambam einerseits Regeln für die grosse Masse festlegen und andererseits beschreiben, wie sich angesehene Persönlichkeiten zu verhalten haben. Gemäss dieser Halacha (jüdische Gesetzesauslegung) gehört heute jedermann zur Gruppe der angesehenen Persönlichkeiten. Dieser Gedanke stammt nicht von mir. So entschied der Chafez Chajim für seinen Sohn: "Dafür bist du genug als Talmid Chacham erkennbar."
Der Chatam Sofer (1762 – 1839) erwähnt in seinen Responsen (Antworten auf jüdische Rechtsfragen) den Passuk (Vers): "Ihr sollt rein dastehen vor G'tt und vor Israel." [Bamidbar 32:22] (Dieser Passuk steht im Zusammenhang mit Mosches Antwort auf das Ersuchen der Stämme Gad und Re’uwen, ihren Erbteil vom Gebiet auf der Ostseite des Jordan zu erhalten.) Der Chatam Sofer fragt, warum Mosche die Stämme zuerst warnte, dass sie mit G'tt im Reinen sein müssten und erst nachher erwähnt, dass sie auch mit Israel im Reinen sein sollten. Es ist anzunehmen, dass das Einfachere zuerst Erwähnung findet und dann das Schwierigere. Daraus schliesst der Chatam Sofer, dass es einfacher ist, mit G'tt im Reinen zu sein, als mit seinen Mitmenschen.
Daraus, stellt der Chatam Sofer fest, leitet sich die folgende Lehre König Schlomo's (Salomon) ab: "Es gibt auf Erden keinen Gerechten, der nur Gutes tut und nie sündigt." [Kohelet/Prediger 7:20] Niemand kann den Verdächtigungen und der Kritik seiner Mitmenschen entgehen, auch für das Tun, das in G'ttes Augen gut ist. Der Chatam Sofer vermutet, dass die Stämme Gad und Re’u'wen Mosches Wunsch vollkommen erfüllten. Sie erfüllten alle Abmachungen, die Mosche festgelegt hatte. Sie überschritten den Jordan und gingen ihren Brüdern im Kampfe voran. Erst nach der Eroberung und der Besitznahme der anderen Stämme kehrten sie zu ihrem Erbbesitz zurück. Trotz alledem, so schreibt der Chatam Sofer, beklagten sich die Menschen immer noch über das Verhalten dieser beiden Stämme. Die Menschen sagten: "Ihre Familien leben schon in Sicherheit. Drüben, auf der anderen Seite des Jordans ist es ruhig. Wir sitzen hier immer noch auf unseren Koffern. Hier wird immer noch gekämpft …" Die Menschen finden immer etwas, worüber sie sich beklagen können.
Der Chatam Sofer weist ausserdem darauf hin, dass dies der Grund war, weshalb die Stämme vom Ostufer des Jordans zuerst ins Exil gehen mussten. Technisch hatten sie zwar ihren Teil der Abmachung erfüllt. Was G'tt anbelangte, waren sie korrekt. Das "Volk" aber vergab ihnen nie. Die Klagen rissen nie ab. In den Augen Israels waren sie nicht rein. Und aus diesem Grund waren sie die ersten Stämme, die mit dem Exil bestraft wurden. Dieser Gedanke ist sehr erschreckend.
Ich möchte mit den Worten von Rabbejnu Bachja (1263 – 1340) zu dieser Parscha enden. Der Passuk lautet: „Du sollst Meinen Heiligen Namen nicht entweihen; Ich will unter den Kindern Israels geheiligt werden… [22:32]." Dies scheint eine unpassende Gegenüberstellung. Ein Nebeneinander von Chillul Haschem (Entweihung) und Kidusch Haschem (Verherrlichung des G'ttlichen Namens) in einem Atemzug ist sehr ungewöhnlich.
Rabbejnu Bachja bemerkt, dass die schlimmste Sünde Chillul Haschem ist. Chasal (unsere Weisen) erklären (Traktat Joma 86a), dass es für diese Sünde im Leben des Menschen keine vollkommene Sühne gibt; erst die Kombination von Teschuwa (Rückkehr, Reue), Jom Kippur (Versöhnungstag), Jissurim (Leiden) und Tod bringt für die Entweihung des G'ttlichen Namens eine vollkommene Sühne. Zusammen mit Rabbejnu Jona und weiteren Rischonim weist er jedoch darauf hin, dass es eine Sühne für Chillul Haschem gibt: ‘Kidusch Haschem’. Aus diesem Grund stellt der Passuk beides nebeneinander. Achte darauf, den Namen G'ttes nie zu entweihen. Falls du es aber doch gemacht hast, gibt es einen Ausweg: die Heiligung Seines Namens.
Wenn jemand bewirkt hatte, dass sich Menschen vom Judentum abwenden, wenn jemand Menschen dazu bringt, dass sie sagen: "Wenn ein religiöser Jude so handelt, wollen wir nichts damit zu tun haben", so gibt es noch einen Ausweg: "… Ich will unter den Kindern Israels geheiligt werden." Das ist auch gemeint mit dem Ausspruch des Talmuds: "Wenn jemand ehrliche Geschäftsbeziehungen mit seinen Mitmenschen unterhält, so sagen die Leute über ihn: 'Wohl dem, der Tora lernt; wohl dem, der ihn Tora lehrte.' [Traktat Joma 86a]" Wer die wahre Kraft der Tora offenbart und Menschen auf diese Weise näher zur Tora bringt, erfüllt das G'tteswort: "Du bist mein Diener Jisrael, durch den mein Ruhm verkündet wird" [Jeschajahu 49:3]. Für jemanden, der einen Chillul Haschem gemacht hat, ist dies das einzige Gegenmittel.
Quellen und Persönlichkeiten:
- Rischonim („die ersten“): Toragelehrte zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert.
- Rambam, Akronym für Rabbi Mosche ben Maimon (Maimonides) (1135 – 1204); Spanien, Ägypten, Israel. Einer der bedeutendsten Rischonim, seine Hauptwerke sind: Das umfassende Werk zum jüdischen Recht „Mischne Tora-Jad Hachsaka“, Erklärung zur Mischna und „Moreh Newuchim“ (Führer der Irrenden / Unschlüssigen), wie weitere Werke.
- Rabbejnu Jona ben Abraham Gerondi (1200-1263); Girona, Barcelona und Toledo, Spanien. Rabbiner und Rosch Jeschiwa. War einer der bekannten Rischonim. Cousin des Ramban (Nachmanides). Bekannt durch seine Werke: „Scha’arej Teschuwa (Lehre über moralisches Verhalten)“, Erklärungen zu Pirkej Awot und Mischlej, wie Abhandlungen zum Talmud (grosser Teil ging verloren).
- Rabbejnu Bachja ben Ascher (1255 – 1340); Kabbalist, bekannt vor allem durch seinen Pentateuch-Kommentar "Rabbejnu Bachja", wie auch "Kad Hakemach" und weitere Werke. Saragossa, Spanien. Er war ein Schüler von Rabbi Schlomo ibn Aderet (Raschba), einer der bedeutendsten Rischonim. Er wird oft mit Rabbejnu Bachja ben Josef ibn Pakuda (auch aus Saragossa), Verfasser von "Chowot Halewawot" verwechselt.
- Chatam Sofer (1762-1839) [Rabbi Mosche Sofer / Schreiber]; Pressburg/Bratislava, Slowakei. Rosch Jeschiwa und einer der führenden Rabbiner des 19. Jahrhunderts. Er schrieb zahlreiche Werke, wie acht Bände Responsen, 18 Bände Erklärungen zum Talmud, Kommentare zur Tora, Briefe, Gedichte und ein Tagebuch. Die meisten Werke tragen den Namen „Chatam Sofer“.
- Chafez Chajim: (1838-1933): Rabbi Jisrael Me’ir HaKohen von Radin. Autor grundlegender Werke zu jüdischem Recht und jüdischen Werten (Halachah, Haschkafah und Mussar), wie die Werke ‚Mischna Berura‘, ‚Chafez Chajim‘, ‚Schmirat Halaschon‘, Machaneh Israel Einer der prominentesten Führer des orthodoxen Judentumsvor dem 2. Weltkrieg.
Er war ein Pionier mit seinen Werken. Im Jahr 1873, im Alter von fünfunddreissig Jahren veröffentlichte er anonym sein erstes Werk, ‘Chafez Chajim’, in dem er klare religiöse Vorschriften gegen Üble Nachrede, Verleumdung und Klatsch (hebr. Laschon Hara) formuliert. Der Titel kann mit ‘der das Leben will’ übersetzt werden und stammt aus Tehilim/Psalm 34,13–14: „Wer ist der Mann, der Leben begehrt (haChafez Chajim), der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen“. Der Chafez Chajim legte grossen Wert auf die Einhaltung dieser Gesetze und verfasste auch ein Morgengebet dazu. In einem zweiten Buch, ‘Schmirat haLaschon’, veröffentlichte er 1876 eine Fortsetzung mit ethisch-moralischen Erklärungen der Wichtigkeit dieser Gesetze.
Sein bekanntestes, heute weit verbreitetes und im aschkenasischen Judentum als massgeblich anerkanntes Werk ist sein sechsbändiger Kommentar zum Schulchan Aruch, Teil ‘Orach Chajim’: ‘Mischna Berura’ (deutsch ‘Klare Lehre’ 1884–1907), an dem er, unterstützt von seinem Sohn und seinen Schwiegersöhnen, rund fünfundzwanzig Jahre gearbeitet hat. Der Mischna Berura kommentiert den Teil Orach Chajim des Schulchan Aruch Satz für Satz. (Der Schulchan Aruch wurde von Rabbi Josef Karo (Zefat/Safed 1488-1575), verfasst, mit den Anmerkungen von Rabbi Mosche Isserles, (Krakau 1520-1572); bekannt mit dem Akronym ‘Rem’a’). - Rav Avraham Ja‘akov Pam (1913 - 2001): Führender Gelehrter; war Rosch-Jeschiwa der Yeshiva Torah Vodaas in Brooklyn, New York.
_________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
Copyright © 2025 by Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum, Zürich. Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com
Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum.
Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.