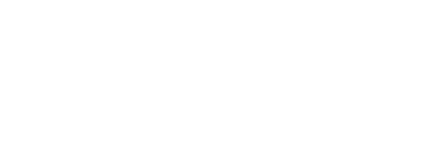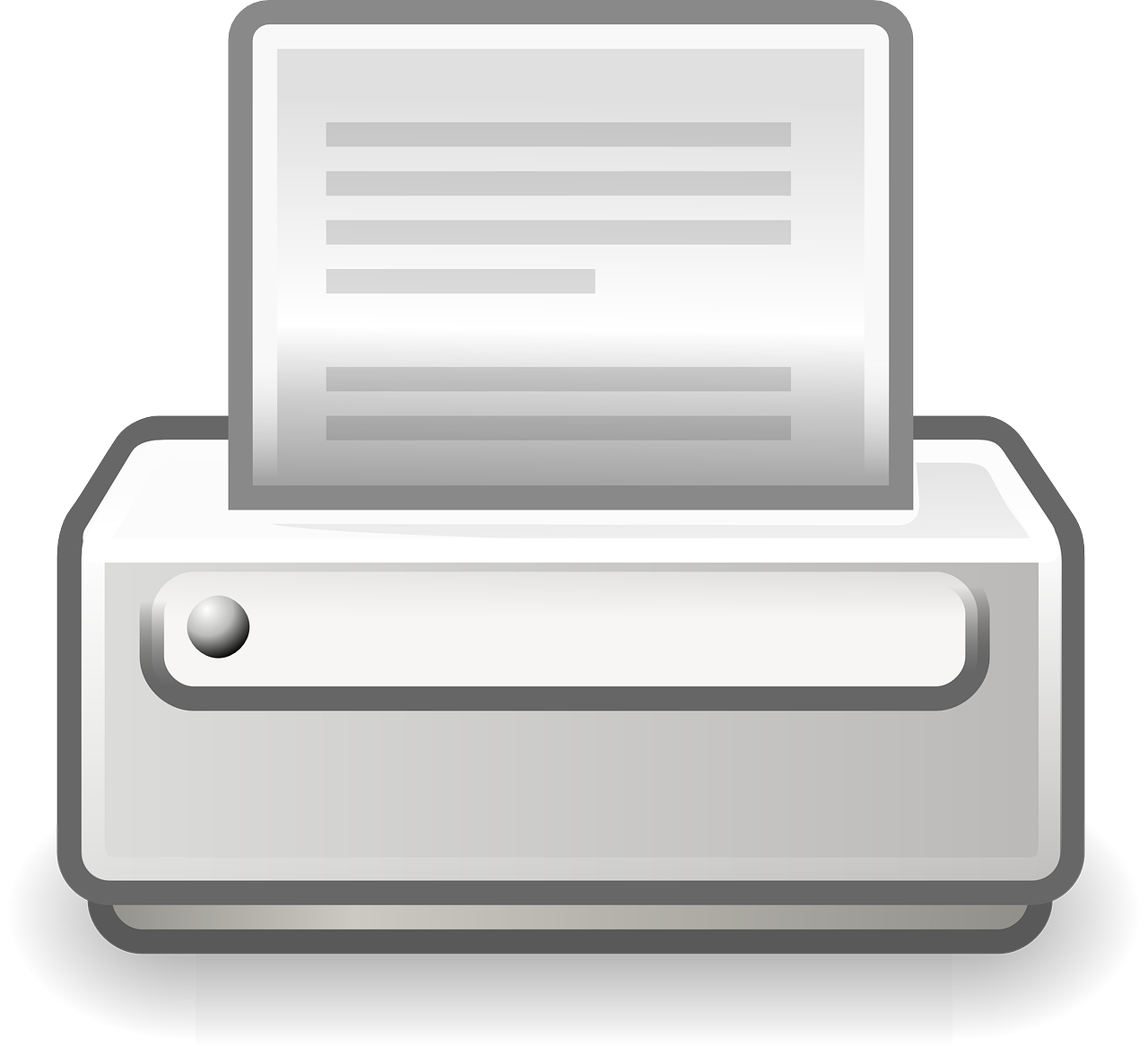Amalek und Klall Jisrael an zwei Enden des Spektrums
Rav Zev Leff zu Purim 5785
Bearbeitet und ergänzt von S. Weinmann
Aus DJZ, 10. Adar 5766 / 10. März 2006
Die Namen aller Jamim Towim beschreiben normalerweise das Motiv des Tages und dessen Bedeutung. Purim scheint aber eine Ausnahme zu sein, denn es weist auf ein scheinbar unbedeutendes Detail der Megilla hin, nämlich die Art und Weise, wie Haman das Datum bestimmte, um die Juden zu vernichten.
Dieser Name scheint den Inhalt des Tages nicht in sich zu fassen.
Eine weitere Schwierigkeit ist die Tatsache, dass die Megilla es für notwendig hält, das Wort “Pur” zu übersetzen. “Pur hu haGoral – Pur, dies ist das Los”. Und wenn “Pur” der persische Ausdruck für “Goral” ist, weshalb benützt dann die Megilla nicht das bekanntere Wort “Goral”? Weshalb muss “Pur” überhaupt erwähnt werden?
Um die wahre Botschaft von Purim zu erfassen, müssen wir zuerst den Vorfahren Hamans verstehen, also Amalek. Nach den Wundern des Auszugs aus Mizrajim (Ägypten) und der Spaltung des Jam Sufs (Schilfmeer) war die ganze Welt in Ehrfurcht vor dem Klall Jisrael und Hakadosch Baruch Hu erstarrt, Der sie erlöst und beschützt hatte. Nur Amalek weigerte sich anzuerkennen, dass es eine G”ttliche Kraft war, die diese Geschehnisse leitete. Er sah darin nur blindes Glück und Zufall.
Was unterschied Amalek wirklich von den anderen Völkern? Dass er spottete.
Der Midrasch Tanchuma (Paraschat Jitro 3) erklärt den Passuk in Mischlej/Sprüche (19:25): ” Schlägt man den Spötter, so wird der Einfältige klug” damit, dass der Spötter sich auf Amalek bezieht und der Einfältige auf Jitro.
Rabbi Zadok Hakohen von Lublin (Zidkat Hazaddik 260) erklärt, dass der Spötter an nichts glaube, während der Einfältige alles glaube. Seit der Zeit, in der die Menschen
erschaffen wurden, gab es entweder solche, die an G”tt glaubten, oder Götzendiener, die glaubten, dass die verschiedenen Kräfte der Welt unabhängig und intelligent funktionierten und als Götter angebetet werden müssten. Diese Götzendiener, wie ursprünglich auch Jitro, glaubten alles.
Amalek war der erste, der den Atheismus einführte: die Philosophie des Nichtglaubens. Er war der Meinung, dass die Welt weder erschaffen wurde noch von einer intelligenten Macht geführt wird, sondern nur durch die blinden Kräfte der Natur geleitet wird.
Obwohl Götzendienst unrecht und schlecht ist, ist er weniger schlimm als der Atheismus. Götzendienst kann als Sprungbrett zum Glauben an G”tt benützt werden, wie es bei Awraham Awinu und bei Jitro der Fall war. Wenn man mit einem Glauben an gewisse Kräfte beginnt, die erschaffen und beeinflussen können, kann man später logisch daraus folgern, dass es eine Kraft geben muss, die über alles erhaben ist und all diese anderen Kräfte schuf und leitet.
Die Philosophie des Leugnens aber, die alles dem Zufall zuschreibt, wird niemals dazu führen, an G”tt zu glauben.
Der Maharal (Nezach Jisrael 60) erklärt, dass Amalek den Gegensatz zu Klall Jisrael darstellt. Wir sind “Rejschit”, der Anfang des Spektrums der Menschheit, und Amalek steht am anderen Ende des Spektrums und wird ebenfalls “Rejschit” genannt, wie es heisst: “Rejschit Gojim Amalek” (Bamidbar 24:20). All die anderen Völker sind in der Mitte, und es besteht ein fortwährender Kampf, der einem Tauziehen gleicht. Wir streben danach, die Welt zu beeinflussen, ihren Götzendienst zu verlassen und an den einzigen G”tt zu glauben. Amalek hat es sich dagegen zum Ziel gesetzt, die Welt so zu beeinflussen, dass sie vom Götzendienst ablässt und atheistisch wird.
Als die götzendienenden Völker die Wunder des Auszugs miterlebten, schrieben sie diese einer intelligenten Kraft zu, die das jüdische Volk leitete und schützte. Diese Kraft musste respektiert werden, und daher hatten sie Angst davor, das jüdische Volk anzugreifen.
Amalek jedoch, der hartnäckige Atheist, schrieb all diese Wunder dem Zufall zu, einem Produkt blinder Kräfte und glücklicher Umstände. Für ihn gab es nichts zu befürchten, um ihn von einem Angriff abzuhalten.
Dass man eine Spaltung des Meeres sehen und diese noch immer dem blinden Zufall zuschreiben kann, wird von der lächerlichen Theorie des Wissenschaftlers Emanuel Velekovsky unterstützt. Dieser behauptet, wissenschaftlich beweisen zu wollen, dass die Wunder beim Auszug aus Ägypten tatsächlich stattfanden. Er schreibt sie aber der Laufbahn der Venus und einem knapp verfehlten Zusammenprall mit der Erde zu!
Die Tora beschreibt Amalek als denjenigen, der euch auf dem Weg zufällig begegnete – “karcha baDerech”. Amalek betrachtet alles nur als Zufall! Er wird auch als “nicht G”ttesfürchtig” (Dewarim 25:18), bezeichnet. Er weigerte sich, die Verbindung G”ttes mit der Welt und den Geschehnissen der Welt anzuerkennen. Als Atheist bestritt er auch den Begriff “andere Götter” – andere intelligente Kräfte. Das Wort, das im Zusammenhang mit der Beschreibung von Amaleks Angriff an verschiedenen Stellen des Tanachs immer wieder verwendet wird, heisst “baDerech – auf dem Weg” (Dewarim 25:17-18, Schmuel I, 15:2).
Im Gegensatz zu jemandem, der daran glaubt, dass die Welt einen Zweck verfolgt und es einen Weg gibt, wie man zu leben hat, glaubt ein Atheist nur an den reinen Zufall und bestreitet solch einen Weg.
Daher griff uns Amalek auf unserem Weg zum Berg Sinai an, um uns vom Empfang der Tora abzuhalten. Er bestritt das Konzept eines Wegs, der der Welt Ordnung und Bedeutung verschafft.
Das erklärt auch ein weiteres Wort, das im Zusammenhang mit Amalek verwendet wird, “Machar – morgen”. Wir finden, dass Mosche Rabbejnu Jehoschua sagt, er solle “morgen” gegen Amalek kämpfen (Schemot 17:9). Gleichermassen sagt Esther in der Megilla zum König, dass sie ihn “morgen” darüber informieren werde, was ihr Wunsch sei. Amalek, der Atheist, hat kein Morgen. Für ihn gibt es nur das Heute und den Zufall, der sich entweder fortsetzt oder auch nicht. Viele Sefarim weisen darauf hin, dass der Zahlenwert von Amalek (240) den gleichen Zahlenwert wie “Safek (240) – Zweifel” – hat.
Amaleks felsenfeste Ablehnung der Verbindung G“ttes mit den Ereignissen in der Welt schwächt unseren Glauben durch das Auftreten von Zweifeln.
Amalek untergräbt G”ttes Thron und verursacht, dass Sein Name unvollkommen ist, wie es in der Tora – Ende Paraschat Beschalach (Schemot 17:16), im Abschnitt, der am Purim gelesen wird – heisst: “…ki Jad al Kejs J-ah…” anstatt “Kissej” (Thron), steht nur “Kejs” (unvollständiger Thron), und statt dem vierbuchstabigen G-ttlichen Namen, stehen nur die ersten zwei Buchstaben “J-ah”! G”ttes Thron stellt unsere Erkennung Seiner Herrschaft über die Welt dar, und Sein Name deutet auf die G”ttlichen Attribute hin, mit denen wir uns auf Ihn beziehen. Solange Amalek besteht, ist die Erkenntnis G”ttes nur teilweise und reduziert.
Ein weiterer Unterschied zwischen Amalek, dem Atheisten, und den anderen Feinden unseres Volkes, den Götzendienern, ist die Art und Weise, wie sie das jüdische Volk betrachten. Die Gemara (Megilla 14b) vergleicht die Dialoge zwischen Haman und Achaschwerosch mit einer Diskussion zwischen einer Person, die in ihrem Besitz einen unwillkommenen Graben hat, und einer anderen, die einen unerwünschten Erdhügel hat. Diejenige mit dem Graben sagt zur anderen: “Verkaufe mir deinen Erdhügel, um meinen Graben zu füllen.” Darauf erwidert die zweite Person: “Du kannst ihn umsonst haben, da er mich stört.”
All unsere anderen Feinde kannten unsere Bedeutung und wollten uns aus Angst oder Neid zerstören. Sie können mit Achaschwerosch verglichen werden, der das jüdische Volk als einen Erdhügel betrachtete, als etwas Substantielles, das aber sein Eigentum abwertete. Amalek jedoch, der durch Haman vertreten wird, sah uns als Grube an, als etwas nicht Existierendes. Er wollte uns aus völliger Abscheu und Feindschaft eliminieren.
In Wirklichkeit verfügt das jüdische Volk über eine besonders grosse Bedeutung. Die Tora erklärt uns: “Denn welche Nation, mag sie noch so gross sein, der ihre Götter so nahe sind, wie der Ewige unser G-tt uns, so oft wir ihn rufen? Und wo ist eine Nation, mag sie noch so gross sein, die so gerechte Gesetze und Rechtsvorschriften hätte, wie sie die ganze Lehre enthält, die Ich euch heute vorlege?” (Dewarim 4:7-8). Unsere Grösse liegt in unserer Nähe zu Haschem, ausgedrückt durch die Effizienz unserer Gebete und der Tatsache, dass wir G”ttes Tora erhielten, die jede unserer Taten, unsere Sprache und Gedanken leitet. Diese einzigartigen Elemente betonen die ewige und universelle Bedeutung eines Juden.
Ein Götzendiener kann diese Kraft verstehen, die uns leitet und beschützt. Er kann auch die Schönheit und Perfektion sehen und vielleicht sogar erkennen, dass sie dem Leben Bedeutung verleihen. Allerdings kann dies zu Missgunst führen. Es kann sein, dass sie neidisch sind und uns hassen, doch müssen sie uns anerkennen.
Andererseits bestreitet ein Atheist alle Merkmale des jüdischen Volkes, und lehnt jede intelligente Führung der Welt ab und folgt der Philosophie, dass der Stärkere überlebt, dass “Macht Recht schafft”. Eine Nähe zu G”tt und die gerechten Gesetze, um das Leben zu leiten, sind Konzepte, die für einen Atheisten vollkommen bedeutungslos sind. Amalek, der Atheist, lehnt damit auch die Besonderheit des jüdischen Volkes ab.
In diesem Licht können wir die Ursprünge Amaleks verstehen. Seine Mutter war Timna, die mehrmals kam, um sich dem Haus von Awraham Awinu als Übertretende anzuschliessen, und jedes Mal zurückgewiesen wurde. Schliesslich wurde sie die Nebenfrau von Elifas, dem Sohn Ejsaws, da sie fand, es sei besser, eine Nebenfrau in der Familie von Awraham zu sein als eine Prinzessin in ihrer eigenen Familie.
Da Timna von den Awot zurückgewiesen wurde, war es für sie und ihren Sohn ganz natürlich, die Awot abzulehnen und die Bedeutung des Klall Jisrael abzuschwächen. Die Psychologie der “sauren Trauben” funktioniert so: “Wenn du mich nicht willst, dann bist du sowieso nicht wichtig, und wer will dich haben?” Der Name Timna deutet jemanden an, der daran gehindert wird (limnoa), sein Ziel zu erreichen.
Daher hatte Amalek einen Grund, die Bedeutung des Klall Jisraels abzuleugnen. Von der Seite seines Vaters Elifas her war er durch Ejsaw beeinflusst, der an die Macht des Schwerts als entscheidenden Faktor der Weltgeschehnisse glaubte. Sein Sohn Elifas verstärkte diesen Standpunkt, indem er die Macht des Geldes aufwertete. Dies zeigte sich, als Elifas von seinem Vater den Auftrag erhielt, seinen Onkel Ja’akow zu ermorden und sich einverstanden erklärte, stattdessen den gesamten materiellen Besitz Ja’akows an sich zu nehmen und auf diese Weise den Befehl zu befolgen. Sein Name allein deutet dies an: “Eli – meine Macht”, ist “Pas – Gold.” Die Grundlage des Atheismus – der Glaube an brutale Macht oder an die Macht des Geldes und als Folge davon die totale Ablehnung der Bedeutung des jüdischen Volkes – das sind die Wurzeln Amaleks.
Aber diejenigen, die aus Neid und Angst gegen uns sind, stärken unseren eigenen Selbstwert auf indirekte Weise. Ihre Feindschaft ist demnach nicht gänzlich negativ. Amalek aber wollte uns unseres Selbstbewusstseins und der Erkennung unseres wahren Wertes berauben, indem er unsere Wertlosigkeit verkündete. Diese Feindschaft hat die Schwächung unseres eigenen Selbstwerts zur Folge. Daher kann nur die völlige Ablehnung Amaleks und dessen Zerstörung uns ermöglichen, unseren wahren Wert zu schätzen und auszudrücken.
Damit können wir nun das Konzept aus einer anderen Perspektive verstehen, dass der Name Haschems und dessen Thron nicht vollkommen sind, bis Amalek zerstört wird. Unser Begriff vom Namen Haschems erfolgt durch die Tora, die als eine Kombination der G”ttlichen Namen beschrieben wird. Sie enthält G”ttes Eigenschaften und ermöglicht uns, Ihn nachzuahmen und G”ttlich zu werden. “G”ttes Thron” ist unser Begriff der G”ttlichen Vorsehung und Seiner Kontrolle über die Welt. Dies sind die beiden Aspekte, die uns von den Völkern der Welt unterscheiden: die Tora und G”ttes besondere Haschgacha (persönliche Zuwendung, Fürsorge und Lenkung) für uns. Diese beiden Begriffe sind aber reduziert, solange Amalek die Welt beeinflusst.
Amaleks ursprünglicher Angriff war das Ergebnis davon, dass die Benej Jisrael fragten: “Ist G”tt wirklich mit uns oder nicht?” (Schemot 17:7) Chasal sagen, sie lagerten in “Refidim”, das bedeutet, dass ihre Hände in Bezug auf die Tora schwach wurden (“Refidim”, Akronym für “Rafu Jadajim”). “Hände” sind die Verbindung des Menschen mit der Welt und dessen Fähigkeit, auf der Welt zu funktionieren. Die Hände der Benej Jisrael trennten sich von der Tora, da sie den Zusammenhang der Entwicklungen zwischen der materiellen Welt und der Tora, dem G”ttlichen Willen, nicht sahen. Obwohl sie die grossen Wunder von Mizrajim erlebt hatten, zweifelten sie daran, ob G”tt die Ereignisse leitete, selbst als Wunder wie die Spaltung des Roten Meeres notwendig waren, was vom gewohnten Ablauf der materiellen Welt und den Naturkräften abwich. Geschwächt in der Erkenntnis der G”ttlichen Vorsehung, konnte Amalek, der Abstreiter der G”ttlichen Vorsehung, angreifen.
Um Amalek entgegenzuwirken, musste das jüdische Volk seine eigene Erkenntnis der Macht G”ttes über die Welt stärken. Um dies zu erreichen, stand Mosche Rabbejnu auf dem Hügel und hob seine Hände zum Himmel an. Solange seine Hände erhoben waren, verlief der Kampf zugunsten von Klall Jisrael. Sanken seine Hände herab, wendete sich das Blatt.
“Mosches Hände” waren aber eine Prüfung. Würden die Benej Jisrael ihren Erfolg Mosches Händen zuschreiben oder über sie hinwegsehen, um Haschems Vorsehung zu erkennen, die durch diese Hände manifestiert wurde? Konnten sie die scheinbar wirksamen Kräfte ignorieren, um die Kräfte zu erkennen, die wirklich von Haschem stammen?
Nach dem babylonischen Exil wurde das jüdische Volk einmal mehr in Bezug auf Haschems absolute Kontrolle über die Welt verwirrt. Als Newuchadnezar verfügte, dass man sich vor seiner Statue bücken sollte, befolgten dies auch die Jehudim, da sie die Konsequenzen einer Weigerung befürchteten. Sie begriffen nicht, dass es G”tt war, nicht Newuchadnezar, Der ihr Schicksal kontrollierte.
Später verstärkten sie diese Sünde noch, als sie die Warnung Mordechais missachteten, nicht am Bankett von Achaschwerosch teilzunehmen. Dies war angeblich ein notwendiger politischer Schritt, um ihre Position im Königreich von Achaschwerosch sicherzustellen. Mordechai warnte sie, dass dies das jüdische Volk in Wirklichkeit in Gefahr versetzen würde, da es gegen G”ttes Willen verstiess.
Selbst wenn die Teilnahme an den Festlichkeiten, wie manche Kommentare es verstehen, unter die Gesetze von Pikuach Nefesch – Lebensgefahr – fiel, sündigte das jüdische Volk dadurch, dass es das Fest genoss. Sie zeigten, dass sie das Bankett nicht als etwas betrachteten, zu dem sie gezwungen waren, sondern als etwas Positives, das ihren Status im Königreich aufwertete.
Wenn ein Jude sich weigert, sich dem Willen G”ttes zu fügen und sein Leben zu opfern, wenn er es nötig findet, sich vor Newuchadnezars Statue zu bücken, dann ist seine Lebensauffassung völlig verzerrt. Selbst wenn es ihm erlaubt ist, zum Zweck des Überlebens eine Awejra (Sünde) zu begehen, wie es beim Fest von Achaschwerosch der Fall war, sieht er die warnende Hand G”ttes nicht, sondern geniesst die Sünde. Geschwächt durch den Mangel, G”ttes stete Leitung der Welt zu erkennen, war das jüdische Volk den Plänen von Amaleks Nachkommen Haman ausgesetzt. Haman wollte das jüdische Volk auf eine Art zerstören, bei der die zufällige Natur der Weltgeschehnisse betont würde. Daher wählte er das Datum der “Endlösung” durch die Ziehung eines Loses. Dies betonte seine völlige Ablehnung von geplanten und vorbestimmten Weltgeschehnissen.
In diesem Sinn übersetzt die Megilla das Wort “Pur” nicht, sondern verkündet Hamans Philosophie: “Pur” – das Los, hu haGoral, das ist das Schicksal (des jüdischen Volkes), das durch den Zufall bestimmt wird. “Pur hu haGoral” ist keine Übersetzung, sondern Hamans Motto.
Der Name Purim betont demnach die Zurückweisung von Hamans Philosophie. Er deutet an, dass sogar das, was nur als reiner Zufall erscheint – das “Pur” (Los) – in Wirklichkeit Ausdruck des G”ttlichen Willens und Weltplans ist.
Die Juden mussten Haman genau auf diesen Gebieten bekämpfen, in denen ihre Sünden sie gegenüber seinen üblen Plänen verletzbar gemacht hatten. Dass Mordechai sich nicht vor Haman bückte, sühnte dafür, dass sie sich vor der Statue Newuchadnezars gebückt hatten.
Mordechai erkannte seinen eigenen Wert als Jehudi – einem, der den Götzendienst ablehnt. Die von Herzen kommenden Gebete des Klall Jisraels betonten ihren Glauben an Haschem als ihren einzigen wahren Retter. Esther, die gezwungen war, Gesetze zu übertreten und mit einem Nichtjuden zusammenzuleben, erlangte durch ihre Stellung als Königin Persiens weder Vorteile noch Vergnügen und betrachtete es als ihre einzige Ehre, eine jüdische Frau zu sein, die mit dem jüdischen Volk und Haschem in Verbindung stand. Dies wirkte dem Genuss entgegen, den die Juden verspürten, als sie gezwungen wurden, an Achaschweroschs Bankett teilzunehmen.
Somit stellte das Wunder der Purim-Rettung die wahre Bedeutung des jüdischen Volkes wieder her: mit Mordechai, dem Anführer und Symbol des jüdischen Volkes, erhaben, respektiert und geehrt.
All die verschiedenen Mizwot von Purim können im Licht dieser beiden Gedanken – der Erkennung der G”ttlichen Vorsehung und Wahrnehmung der Wichtigkeit des jüdischen Volkes – verstanden werden. Das Lesen der Megilla drückt die Tatsache aus, dass die Geschichte an sich bezeugt, dass G”tt die Geschehnisse lenkt. Hinter den unzähligen Ursachen und Wirkungen, die in der Megilla erwähnt werden, kann man die Hand G”ttes erkennen, die alles auf ein Ziel lenkt.
Die Simcha von Purim ist die Freude um das Wissen, dass diese Welt einen Zweck und Plan hat und nicht dem reinen Zufall überlassen ist. Es gibt keine Simcha, die so gross ist wie die Lösung von Zweifeln. Purim behob die Zweifel, die durch Amalek entstanden waren. Diese Simcha ist durch “ad delo joda” ausgedrückt – sich zu betrinken, bis man nicht mehr zwischen dem Segen Mordechais und dem Fluch Hamans unterscheiden kann. Wer Hakadosch Baruch Hu vertraut und merkt, dass Er es ist, Der die Welt führt, kann sich auch in einem Zustand wohl fühlen, in dem das Fehlen eigener Kontrolle äusserst auffallend ist. Auch wenn er nicht sicher ist, was positiv und was negativ ist.
Dieses Wissen gibt dem Juden auch ein Gefühl des intensiven Selbstbewusstseins, denn er spielt im Plan G”ttes eine wesentliche Rolle. Die Erlösung von Purim betont den Wert des materiellen jüdischen Körpers in den Augen G”ttes und in dessen Weltplan. Wir essen und trinken und geben Mischloach Manot, um unsere materielle Existenz und die materielle Existenz anderer, die G”tt so wichtig ist, aufzuwerten.
Zudem geben wir “Matanot leEwjonim”, Geschenke an die Armen, was andeutet, dass unsere Geltung nicht durch Reichtum oder Macht bestimmt wird, sondern dadurch, dass wir G”ttes spezielles Volk sind. Diese Eigenschaft hat auch ein Jude, der mittellos ist. Somit geben wir ihm ein Geschenk – kein Almosen – um zu betonen, dass wir seine
wahre Bedeutung und seinen wahren Wert erkennen, der auch unser wahrer Wert ist.
Obwohl Purim ein Fest der Einheit ist, ist es zugleich das einzige Fest, das nicht alle Juden am selben Tag feiern. Auch daraus kann man lernen, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass alle genau dasselbe tun und ob Leute sich mit anderen Leuten vereinen, die ganz und gar so sind wie sie selbst.
Wahre Einheit wird dadurch erreicht, dass einer, der Purim an einem Tag feiert, mit Bewunderung, Respekt und wahrem Verständnis auf seinen Nachbarn blickt, der ihn an einem anderen Tag feiert. Das ist wahre Einigkeit.
Midrasch Tanchuma: Sammlung von Erklärungen und Aggadot zum Chumasch. Wird nach dem Amora (Talmudgelehrten) Rabbi Tanchuma Bar Abba benannt, da er am häufigsten in diesem Midrasch zitiert wird. Er war ein jüdischer Amora der 6. Generation, einer der bedeutendsten Aggadisten seiner Zeit.
Rabbi Zadok Hakohen Rabinowitsch – Rubinstein von Lublin (1823 – 1900). Chassidischer Weiser und Denker; einer der führenden Tora-Gelehrten des 19. Jahrhunderts. Sein Denken zeichnet sich durch eine Kombination aus gewaltiger Tora-Wissenschaft und den Lehren der Kabbala und des Chassidismus aus. Er gehörte zu den Chassidim von Rabbi Mordechai Josef Leiner, den „Isbizer Radsiner Chassidim“ und zu Rabbi Jehuda Leib Eigers „Lubliner Chassidim“. Erst als seine Rebbes die Welt verliessen, willigte er ein, die Bürde eines chassidischen Rabbis auf sich zu nehmen. Man erzählt über ihn, dass er nie essen wollte, bis er nicht einen Traktat des Talmuds zu Ende gelernt hatte und einen Sijum machen konnte. Das geschah in der Regel jeden Abend! Mit siebzehn Jahren verfasste er bereits sein erstes Werk. Danach folgten unzählige weitere, wie die bekannten Werke Pri Zaddik, Zidkat Hazaddik, etc. Leider ging ein Teil seiner Werke, als Manuskripte, im Holocaust verloren.
______________________________________________________________________________________________________
Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich
________________________________________________________________________________________________________
Copyright © 2025 by Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum.
Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema’an Achai / Jüfo-Zentrum. Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.