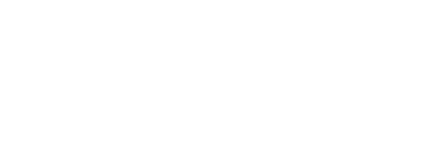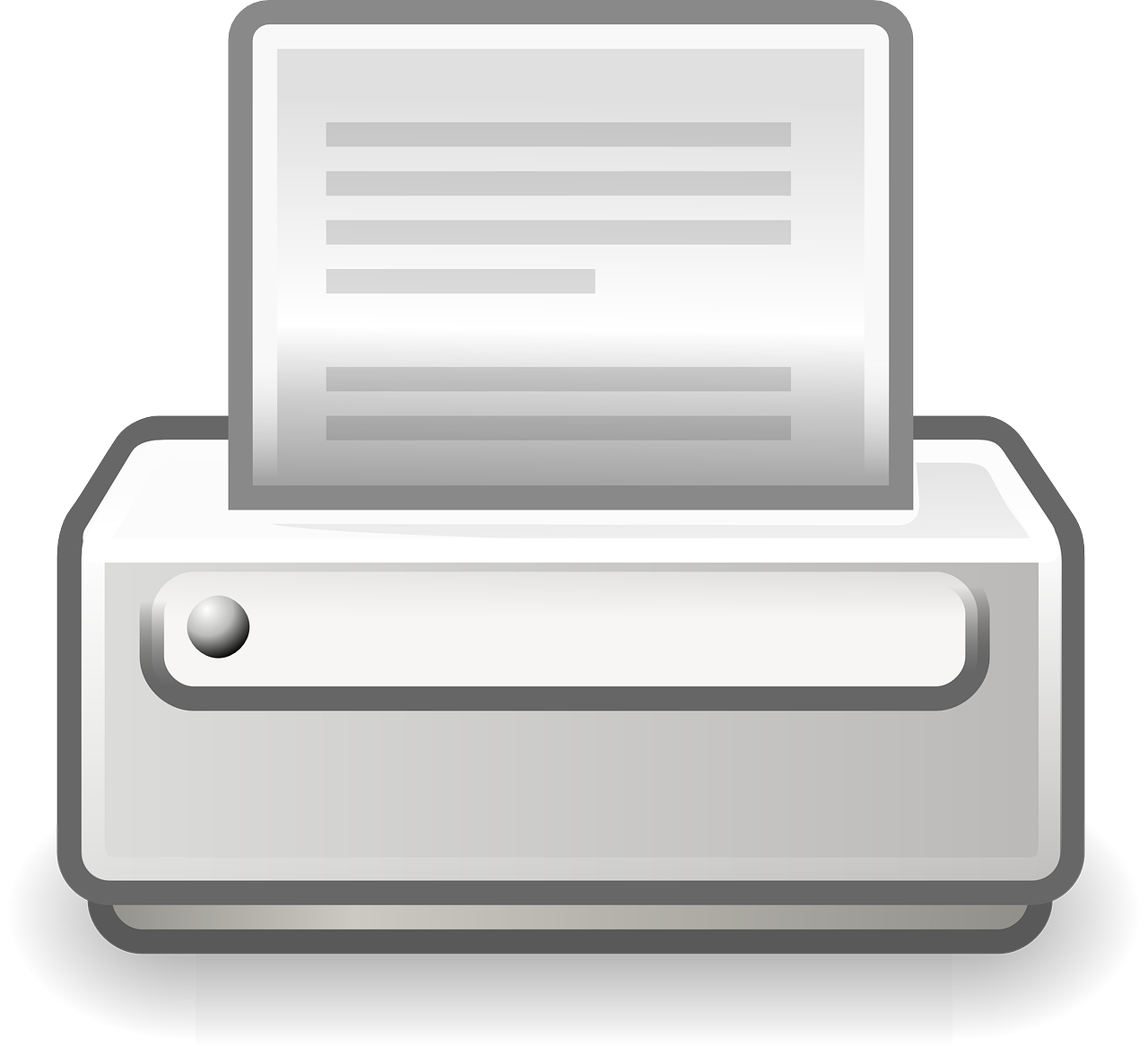Nachruf in Erinnerung an Zipora Barnea, sel. A.
(von ihrem Sohn, Gill Barnea, langjähriges Jüfo-Redaktionsmitglied)
בס״ד
Das abgelaufene Jahr 5782 wird mir für immer als ein trauriges in Erinnerung bleiben, denn in diesem Jahr starb meine Mutter. Ich schreibe diese Zeilen in der Küche, wo wir endlos viele Stunden unseres Lebens miteinander verbracht haben. Auf der Schiebetür zur Vorratskammer hängt seit Jahrzehnten ein Bild, das ich noch als Kleinkind gemalt habe: Meine Eltern als Schlümpfe und darüber eine Sprechblase: „Guten Morgen, Mama und Papa!“
In meiner frühesten Erinnerung – es war Winter – liess mich meine Mutter zum ersten Mal allein zu Hause. Sie zog ihren Mantel an und erklärte mir, dass sie nur kurz einkaufen gehen würde, um ein paar Kleinigkeiten zu besorgen. Sie würde bald zurückkommen – ich solle keinen Unfug machen… Als mir bald darauf bewusst wurde, dass meine Mama mich allein zurückgelassen hatte, lief ich in Pyjama und Hausschuhen – ohne Jacke – auf die Strasse und rief völlig aufgelöst in alle Himmelsrichtungen: „Wo ist meine Mama?!“ – In kürzester Zeit scharten sich etliche Leute um das weinende, frierende Kind: Nachbarn, Passanten sowie ein jüdischer Arzt, der in der Nähe wohnte. Sie alle versuchten, mich zu trösten – und nur kurz darauf kam mir Mama mit der Einkaufstüte entgegen und nahm mich in den Arm.
Ich war ihr absolutes Wunschkind und kam als Nachzügler zur Welt – vierzehn Jahre nach meiner Schwester. Meine Eltern wohnten zur damaligen Zeit in Unterbach – am Stadtrand von Düsseldorf. Meine Mutter war 1940 in der nordisraelischen Hafenstadt Haifa geboren worden und diente nach dem Schulabschluss zwei Jahre lang als Soldatin auf den Golanhöhen.
Zunächst schien ihr eine Karriere als Malerin vorgezeichnet, als ihr die renommierte Kunstakademie Bezal’el in Jerusalem ein Stipendium anbot. Ein führender Galerist aus Tel Aviv erkannte ebenfalls ihr Talent und wollte ihre Werke ausstellen. Er kam eigens mit dem Auto nach Haifa, um ihre Bilder abzuholen. Doch auf dem Rückweg baute er einen schweren Unfall, bei dem ihm der andere Fahrer mit voller Wucht in den Kofferraum krachte – womit alle Bilder unwiederbringlich zerstört waren!
Neben der Kunst hatte meine Mutter ein zweites grosses Talent – die Musik. Sie hatte ein absolutes Gehör und spielte ausgezeichnet Akkordeon, obwohl sie keine Noten lesen konnte. Zur damaligen Zeit, als es noch längst keine Stereo-Anlagen gab, war es üblich, dass man auf Partys musikalische Gäste einlud, um mit Live-Musik Stimmung zu erzeugen. Auf einer solchen Feier lernten sich meine Eltern kennen, die gleichermassen filigran Akkordeon spielten und – wie sich herausstellen sollte – nicht nur musikalisch miteinander harmonierten.
Sie heirateten 1959, wonach mein Vater sein Studium zum Maschinenbauingenieur an den Technischen Universitäten von Haifa und Birmingham abschloss – und meine Mutter ihre Ausbildung zur Kosmetikerin. Sie sollte später immer wieder sagen, dass wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit geahnt hätte, dass sie mehr als ein halbes Jahrhundert in Deutschland verbringen würde, sie von der Chuppa (dem jüdischen Hochzeitsbaldachin) weggelaufen wäre!
Im Winter 1965/‘66 wanderten meine Eltern nach Deutschland aus – zunächst nach Remscheid, womit sie der Jüdischen Gemeinde Wuppertal angehörten. Meine Schwester war damals vier Jahre alt – und als sie zum ersten Mal den Schnee erblickte, rief sie staunend meiner Mutter zu: „Mama, guck, der liebe G-tt wirft Mehl vom Himmel!“
Für meine Grosseltern in Israel war es zur damaligen Zeit – so kurz nach dem Holocaust – eine Schande, dass meine Eltern ausgerechnet nach Deutschland ausgewandert waren! Sie erzählten ihren Angehörigen stattdessen, dass ihre Kinder in England wohnten. Meine Oma schrieb meiner Mutter einen hysterischen Brandbrief auf Jiddisch, in dem sie ihr prophezeite, dass sie noch mit dem nackten Allerwertesten (das jiddische T-Wort) aus Deutschland fliehen würde!
Es kam jedoch anders: Nach zwei Jahren in Remscheid und zehn Jahren in Unterbach, zogen wir 1977 in die Seydlitzstraße – in unmittelbare Nähe der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Mein Vater gründete ein Ingenieurbüro – später auch einen Stahlhandel. Meiner Mutter wurde eine attraktive Stelle als Kosmetikerin bei einer Parfümerie in der Königsallee angeboten – einer vornehmen Luxusmeile im Stadtzentrum. Doch im Einvernehmen mit meinem Vater entschied sie sich schweren Herzens dagegen – denn meine Schwester und ich sollten nicht als Schlüsselkinder aufwachsen.
Zur damaligen Zeit gab es in Düsseldorf noch keine jüdische Schule, doch meine Mutter schickte mich in den jüdischen Kindergarten, zur Religionsschule – und auch zum Gemeinderabbiner, um mir Privatunterricht zu geben. Sie stammte aus einem Elternhaus, in dem speziell ihre Mutter sehr streng auf die jüdischen Speisegebote achtete und sie auch jeden Freitag zur Frau des Rabbiners schickte, um ihr eine Spende für wohltätige Zwecke zu überreichen. Ihr Vater, der ein Möbelgeschäft besass und kein „ausgewiesen“ frommer Mann war, spendete unter anderem eine ganze Möbelausstattung an eine Witwe, die kein Geld hatte, um ihre Tochter zu verheiraten. All das hat meine Mutter für ihren weiteren Lebensweg sehr geprägt.
Sie stiftete mit meinem Vater eine Thora-Rolle an eine Jeschiwa, schickte ihn und mich zum Lubawitscher Rebben in New York und nahm später auch verstärkt den Schabbat und die Speisegebote auf sich. Gelegentlich fragte sie mich beim Essen, welche Bracha sie sagen sollte, wenn sie sich unsicher war. Sie abonnierte eine orthodoxe Zeitschrift aus Israel, las in grossem Umfang fromme Literatur und teilte ihr Wissen auch leidenschaftlich mit anderen.
Ihr besonderes Augenmerk galt der Zedaka (Wohltätigkeit). Sie spendete nicht nur gerne und regelmässig Bares, sondern auch seelischen Beistand für Menschen in Not. So ging sie bei jeder Gelegenheit Kranke besuchen, brachte ihnen Essen und ging regelmässig mit ihnen spazieren. Zu jüdischen Festen lud sie bevorzugt einsame Menschen ein, damit diese nicht allein zu Hause bleiben mussten. Nach ihrem Ableben fiel von Seiten vieler Angehöriger auffallend häufig die Bemerkung: „Deine Mutter war der einzige Mensch, mit dem ich (immer / über alles) reden konnte!“
Aber auch ausserhalb ihres Freundeskreises war es ihr wichtig, jeden Menschen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln. Wann immer ich etwa Lebensmittel für uns bei einem Lieferdienst bestellte, fragte sie mich niemals zuerst, ob der Lieferbote alles dabei hatte, sondern ob ich ihm Trinkgeld gegeben hatte. Wenn die Haushälterin einmal wöchentlich zur Arbeit eintraf, fragte mich meine Mutter immer sofort, was sie ihr in der Pause zu essen geben könnte – und nicht, welche Aufgaben sie ihr eigentlich erteilen sollte.
Mein Elternhaus werde ich auch ganz besonders für die Gastfreundlichkeit im Gedächtnis behalten. In meinen Erinnerungen sehe ich meine Eltern (jung und gesund) vor mir, wie sie in Anwesenheit zahlreicher Freunde und Bekannte im Wohnzimmer auf dem Akkordeon spielen – auch häufig im Duett – vor reich gedecktem Tisch mit leckeren Speisen und Getränken. Meine Mutter war eine ausgezeichnete Köchin – und sehr gesellig. Begünstigt durch die unmittelbare Nähe zur Jüdischen Gemeinde, kamen viele Menschen auch gerne von dort rüber, um uns zu besuchen. Bei manchen Feierlichkeiten war die Wohnung derart überfüllt, dass die Gäste im Treppenhaus standen!
Nichtsdestotrotz war das Leben meiner Mutter auch von Schicksalsschlägen gezeichnet. Ihr einziger Bruder, den sie sehr geliebt hat, starb auf tragische Weise mit nur 28 Jahren. Mein Vater war viele Jahre schwer krank – und nach seinem Tod begann der gesundheitliche Leidensweg meiner Mutter. Anfang 2014 kam schliesslich die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs!
Was anfangs wie ein sicheres Todesurteil erschien, entpuppte sich zunächst als eine seltene Krankheitsform, die mittels einer Operation zu beseitigen war. Sie unterzog sich dem Eingriff in Heidelberg – und es schien eingangs auch alles nach Plan zu verlaufen. Doch wenige Wochen später traten unerwartete Komplikationen auf…
Als ich sie eines Morgens besuchen kam, schien sie geistig verwirrt zu sein und wurde im Beisein der Pfleger von einem Neurologen untersucht. Ich stand in der Ecke des Zimmers, als er sie fragte: „Frau Barnea, warum starren Sie andauernd zur Decke, während ich mit Ihnen rede? Was sehen Sie denn da oben?“ – Sie gab zur Antwort: „Verse aus der Thora!“
Wenig später, als ich sie abermals besuchen kam, öffnete ich die Tür und sie war nicht mehr da! Ihr Bett war frisch bezogen, der Schrank war leer – ihre Sachen verschwunden! Ich lief auf den Flur und rief völlig aufgelöst in alle Himmelsrichtungen: „Wo ist meine Mama?!“ – In kürzester Zeit scharten sich etliche Leute um mich: Der Stationsarzt, die Krankenpfleger – sie alle erklärten mir, meine Mutter sei in eine angrenzende Klinik verlegt worden (die sogenannte Kopfklinik). Noch in derselben Nacht wurde sie ins künstliche Koma versetzt und einer mehrstündigen Notoperation unterzogen – der noch eine weitere folgen sollte. Ihre Überlebenschancen wurden als äusserst gering eingestuft.
Ein Oberarzt der Intensivstation nahm mich nach einiger Zeit beiseite und sagte, es sei sinnlos, dass ich täglich zu Besuch kam. Meine Mutter sei doch nicht ansprechbar und werde dies nach aller Wahrscheinlichkeit auch nie mehr sein. Er würde an meiner Stelle in den Urlaub fliegen und sich an den Strand legen. Wenn etwas passiert, würde man mich anrufen!
Er fragte auch, ob meine Mutter schon ein Grab hatte! Ich erwiderte, dass ihr vorgesehenes Grab neben demjenigen meines Vaters in Israel sei. Er wandte ein, dass es doch einen hohen bürokratischen Aufwand bedeute, eine Leiche dorthin zu überführen. Ich solle also doch nicht in den Urlaub fliegen, sondern lieber nach Hause fahren und damit anfangen, die voraussichtliche Beerdigung zu organisieren!
Aus dem Warteraum der Intensivstation in Heidelberg rief ich die Frau unseres Rabbiners an, die mit meiner Mutter eng befreundet war – und bat sie um ihren Rat. Sie sagte mir am Telefon, dass Juden keine Beerdigungen für lebende Menschen vorbereiten! Am darauffolgenden Tag ist meine Mutter aus dem Koma erwacht…
Von da an ging es ihr Stück für Stück besser – und es war ein unfassbares Glücksgefühl, als sie nach drei schweren Operationen und monatelangem Krankenhausaufenthalt endlich wieder nach Hause durfte! Ich werde den Tag nie vergessen, als wir mit dem Taxi in der Seydlitzstraße ankamen. Wir waren zurückgekehrt – wir beide zusammen! Baruch Haschem!
So manches, was uns im Alltag selbstverständlich erscheint, musste sie neu lernen – als sei sie von einem fernen Planeten gelandet. Wie ruft man jemanden an? Wie funktioniert eine Kaffeemaschine? Wie hält man eine Fernbedienung? – Später erzählte sie über die Zeit, als sie klinisch tot gewesen war, dass sie in einem „Tunnel“ gewesen sei und ein grelles, weisses Licht erblickt hatte, das heller war als jedes andere Licht, das sie je zuvor gesehen hatte. Als ich sie fragte, ob sie das Licht geblendet hatte, sagte sie nein – es war wunderschön…
Nach einer Schabbat-Mahlzeit sassen wir gemeinsam im Wohnzimmer und lasen – jeder für sich – das Tischgebet („Birkat Hamason“). Nachdem sie fertig war, bemerkte ich, dass sie zurückblätterte und wieder von vorne begann – mehrere Male! Ich sah sie etwas schräg an – und sie erwiderte, ich könne es nicht nachvollziehen, denn sie habe das „g-ttliche Licht“ gesehen! Und ja, ich würde zweifellos an G-tt glauben. Doch der Unterschied zwischen uns beiden sei eben, dass ich nur „gläubig“ sei – sie hingegen „wissend“! Und dieses Wissen verpflichtet…
Eines Morgens bat sie mich, ihr einen grossen Mülleimer zu bringen – den grössten, den wir zu Hause hatten! Sie lag im Bett und ich sollte ihr Bücher herbeibringen, um die Regale in der ganzen Wohnung auszumisten. Säckeweise „belanglose“ Bücher bat sie mich wegzuwerfen, die keinen Bezug zu Thora und Mizwot hatten!
Sie war schon immer gläubig und spirituell gewesen, doch die Erlebnisse von Heidelberg hatten sie zusätzlich beflügelt. Und von allen Mizwot mochte sie ganz besonders die Hawdala – das Ritual am Ausklang des Schabbat. Sie bedeckte eigens ihre Haare, rief mich dann freudig herbei, um gemeinsam mit ihr die Hawdala zu machen – und sang danach ein Lied nach dem anderen!
Wenn sie mit Freundinnen telefonierte, vermied sie es spürbar, Laschon Hara (üble Nachrede) und Rechilut (Klatsch und Tratsch) zu sprechen und lenkte – wann immer es ging – auf Thora-Inhalte um. Sie ermunterte mich dazu, meine gelernten Thora-Gedanken aufzuschreiben und unterstützte die Verbreitung meiner Publikationen auch finanziell. Von den Lektionen des Thora-Unterrichts („Schiurim“), die sie besuchte, machte sie sich detaillierte Aufzeichnungen – und in einer Schachtel entdeckte ich posthum auch eine Vielzahl von Briefen, die sie über die Jahre an den Lubawitscher Rebben geschrieben hatte. Ich möchte einmal zur Grabstätte des Rebben nach New York reisen und die Briefe dorthin bringen.
Meine Mutter gehörte dem allerersten Vorstand von Chabad in Düsseldorf an – und hat sich tatkräftig und finanziell engagiert. Unerschütterlich glaubte sie an die baldige Erlösung und hatte sich im Schrank auch ein weisses Kleid zum Empfang des Maschiach vorbereitet! Sie hatte eine ausgeprägte Neigung zu Ästhetik und Eleganz, zog sich gerne schön an – vor allem solide, klassisch und was man im jüdischen Sinne als bescheiden („zanua“) bezeichnet.
Als ich sie einmal in Holland zu einem Modegeschäft begleitete, hat sie sich aber schier selbst übertroffen: Ich wartete draussen – und nach einiger Zeit kam sie mit einem Schuhkarton heraus, den sie mit leuchtenden Augen vor mir öffnete. Ich erblickte ein wunderschönes Paar in silberner Farbe, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte – und fragte sie verwundert, was sie damit vorhatte. Sie antwortete: „Das sind die Schuhe, mit denen ich bei Deiner Hochzeit tanzen möchte!“ […]
Am letzten Chanukka-Fest bat sie mich nach dem Anzünden der achten Kerze – nach etlichen Jahren – ihr Akkordeon aus dem Keller zu holen. Aufgrund ihres Rückenleidens hatte sie schon seit Jahren nicht mehr darauf spielen können – und vor diesem Hintergrund versuchte ich auch zunächst, sie davon abzuhalten. Doch als sie merklich darauf bestand, lenkte ich ein und brachte das Instrument aus dem Keller. Ich war ziemlich überrascht von dieser Initiative – und im Nachhinein war es vielleicht auch ein Zeichen…
Sie setzte sich auf einen Stuhl, ich öffnete den Koffer, legte ihr das Akkordeon vorsichtig um und hielt während der ganzen Zeit die Gurte fest, um ihren Rücken zu entlasten. Währenddessen spielte sie auf rührende Weise zahlreiche Chanukka-Lieder und Melodien, die ich aus der Kindheit kannte. Als sie erschöpft zum Ende kam, bat sie mich, ihr das Akkordeon abzunehmen und in den Koffer zurückzulegen. Ich ahnte nicht, dass es ihr letztes Konzert war.
In ihrem Testament hat sie das Akkordeon dem Chabad-Zentrum in Düsseldorf vermacht. Falls sich unter den Lesern jemand finden sollte, der darauf spielen kann und dorthin kommen würde, bitte ich herzlich um Kontaktaufnahme. Vielleicht könnte man nach Ablauf des Trauerjahres einen Konzertabend veranstalten – für gute Zwecke und in Erinnerung an sie. Das hätte sie ganz bestimmt gefreut.
In der letzten Zeit litt sie zunehmend unter Schmerzen und körperlicher Schwäche, hatte einen Rollator und war morgens auf einen ambulanten Pflegedienst angewiesen, der sie aufopferungsvoll betreute. Wenn sie in seltenen Fällen einmal unzufrieden mit ihrer Behandlung war, hörte ich zuweilen, wie sie ihrer Pflegerin scherzhalber drohte: „Ich war Soldatin, ich kann auch schiessen!“
Am Nachmittag des 27. Dezember zog sie ihren Mantel an, nahm ihren Rollator und erklärte mir, dass sie nur kurz einkaufen gehen würde, um ein paar Kleinigkeiten zu besorgen. Sie würde bald zurückkommen… Bei ihrer Heimkehr sagte sie mir, ihr sei schlecht – und wurde kurz darauf bewusstlos. Ich alarmierte den Hausnotruf, der bald darauf einen Wiederbelebungsversuch startete. Währenddessen rezitierte ich leise die „Krijat Schma“ – was man idealerweise tun sollte, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Schliesslich kam ein Sanitäter aus ihrem Schlafzimmer heraus und teilte mir mit, dass es leider zu Ende war!
Ich stand tränenüberströmt im Eingangsflur – und bald darauf scharten sich etliche Leute um mich, die zusätzlich herbeigerufen worden waren: Beamte in Feuerwehruniformen, Polizisten, ein Notfallseelsorger – aber auch die ambulante Pflegerin, die völlig schockiert war, nachdem sie am Morgen noch meine Mutter versorgt hatte und keinerlei Vorahnung gehabt hatte… Auch der Rabbiner und seine Frau sind herbeigeeilt.
Ich wurde ins Schlafzimmer gerufen, um mich von meiner Mutter zu verabschieden. Sie lag leblos im Bett. Ich nahm ihre Hand, die schon kalt war – und sprach noch einige Minuten zu ihr. Ich entschuldigte mich, falls ich ihr wehgetan hatte und bat sie, im Himmel für mich zu beten, dass ich ein gutes Leben haben möge. Ich sagte ihr, wie sehr es mir leidtat, dass sie die silbernen Schuhe nie anziehen konnte und bat sie, mir gelegentlich im Traum zu erscheinen und mich wissen zu lassen, wie es ihr geht. Dann kamen drei Bestatter mit einem Leichensack und nahmen sie mit.
Sechs Tage später wurde sie in Israel neben meinem Vater beigesetzt. Trotz der Pandemie und der Tatsache, dass meine Mutter schon seit Jahrzehnten im Ausland gelebt hatte, kamen zum Begräbnis und zur „Schiv‘a“ (der jüdischen Trauerwoche) erstaunlich viele Menschen. Darunter Verwandte, die ich nie zuvor gesehen hatte. Freunde aus Deutschland und der Schweiz, die inzwischen in Israel leben. Aber auch eine Schulfreundin meiner Mutter, die mit ihr zusammen aufgewachsen war und mir herzergreifende Geschichten aus ihrer gemeinsamen Kindheit erzählte.
Aus dem Sohar, dem Hauptwerk der Kabbalah [Wajechi 217], wissen wir, dass es die Seele des Menschen dreissig Tage vor dem Ableben spürt, dass sie den Körper verlässt. Vor diesem Hintergrund bin ich wiederholt gefragt worden, ob meine Mutter irgendwelche Andeutungen gemacht hat, dass sie nicht mehr viel Zeit hatte… Die Antwort ist ja – schon seit Monaten – auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte.
Im Sommer sass ich mit ihr am Computer, um ihr ein neues Kleidungsstück zu bestellen. Es gab drei Farben, die allesamt schön waren – und sie konnte sich nicht entscheiden. Ich wollte ihr eine Freude machen und bot ihr an, doch alle drei zu bestellen. Darauf erwiderte sie, das sei nicht nötig, denn „wieviel Zeit bleibt mir noch zu leben?!“
Vor Rosch Haschana rief sie eine ehemalige Freundin an, mit der sie jahrelang nicht gesprochen hatte. Sie versöhnte sich mit ihr und schrieb ihr anschliessend noch eine Karte, die ich zum Briefkasten brachte. Auch dieser plötzliche Vorstoss – aus schier heiterem Himmel – kam mir irgendwie suspekt vor. Doch ich habe es verdrängt…
Zwei Freundinnen meiner Mutter erzählten mir nacheinander, dass ihnen meine Mutter in den letzten Wochen ihres Lebens angeboten hatte, mit ihr die Kleiderschränke auszusortieren. Das war für meine Mutter höchst ungewöhnlich, weil sie ihr Leben lang „gesammelt“ hatte und sich nur äusserst selten von einem Kleidungsstück trennte. Sie sagte ihren Freundinnen, sie könnten jederzeit vorbeikommen, denn sie habe eine ganze Menge Kleider abzugeben! Sie werde sie sowieso nicht mehr tragen…
Meine Mutter liebte es, Geschenke zu verteilen. Fast jeder, der ihr nahestand, hat zu Hause noch irgend ein Erinnerungsstück, das er von ihr bekommen hat. Nicht nur Freunde und Verwandte, sondern auch etliche Weggefährten – ob jüdisch oder nicht, die ihr irgend etwas Gutes getan hatten. Sie war ein dankbarer Mensch und hat es genossen, anderen eine Freude zu machen. Jedes Jahr schenkte sie auch ihren nichtjüdischen Ärzten, Apothekern und Pflegerinnen etwas zu ihrem Fest.
Am 23. Dezember kam ihre ambulante Krankenpflegerin, die seit sechs Jahren fast jeden Morgen erschienen war, zum letzten Mal. Meine Mutter schenkte ihr Ohrringe und eine Kette. Die Pflegerin freute sich sehr darüber und sagte, sie würde den Schmuck zur Neujahrsfeier anziehen. Darauf wandte meine Mutter ein: „Wer weiss, ob ich bis dahin noch lebe oder sterbe?!“ – Die Pflegerin antwortete: „Aber Frau Barnea, warum sagen Sie so etwas? Bis Neujahr sind es doch nur noch ein paar Tage!“ – Am 27. Dezember ist meine Mutter gestorben.
Vor unserer letzten Kabbalat Schabbat machte sie sich ganz besonders viel Mühe und kochte mir alle meine Leibgerichte. Mehrere Töpfe, die bis oben voll waren und für mindestens eine Woche reichten! Ich bekam das zunächst nicht mit, weil ich infolge meiner Corona-Impfung mit Fieber im Bett lag. Doch als sie fertig war, erzählte sie mir davon und sagte, dass sie völlig ausgelaugt war. Sie könne mir kaum beschreiben, wie schwach sie sich fühle. Sie sei buchstäblich am Ende! Wir waren nur zu zweit und es war mir unbegreiflich, warum sie plötzlich so viel Essen vorbereitet hatte. Hinterher verstand ich es…
Am 2. Januar fand die Beerdigung statt – und im Anschluss an die „Schiv‘a“ flog ich zurück nach Deutschland. Ich landete zunächst in Frankfurt und kam in der Nacht in Düsseldorf an. Es war Glatteis, klirrend kalt, der liebe G-tt warf Mehl vom Himmel. Als das Taxi in die Seydlitzstraße einbog, erinnerte ich mich an die Rückkehr aus Heidelberg. Wenig später schloss ich die Wohnungstür auf, legte den Koffer beiseite – und war ganz allein.
Ich ging zuerst zur Küche, stand einige Zeit regungslos da und schaute auf mein Kinderbild mit den Schlümpfen: „Guten Morgen, Mama…“ – In der Tiefkühltruhe lag noch das Essen, dass sie vor unserem letzten gemeinsamen Schabbat gekocht hatte. Vor meinem Abflug hatte ich es eingefroren. Sie hatte für mich vorgesorgt – vor ihrer letzten Reise…
Nach einigem Zögern traute ich mich schliesslich in ihr Schlafzimmer – in Pyjama und Hausschuhen. Auf ihrem Nachttisch lag das letzte Buch, das sie gelesen hatte: „Antworten auf die Fragen des Lebens – nach dem Lubawitscher Rebben“. Auf der Fensterbank lag der Schuhkarton aus Holland, auf dem Stuhl ihr Mantel, und auf dem Rollator hing noch ihre letzte Einkaufstüte.
Mama ist gestorben. Sie wird nie mehr nach Hause kommen. Doch mit G-ttes Hilfe werde ich schon bald zu ihr nach Jerusalem reisen – mit einem weissen Kleid im Gepäck – zum Empfang des Maschiach.
Gill Barnea
Epilog: Wenige Tage nachdem dieser Artikel fertiggestellt war, erreichte mich die Nachricht, dass auch meine Schwester gestorben ist. Sie wurde 60 Jahre alt.
Für Kommentare zu diesem Nachruf,
kontaktieren Sie mich gerne wie folgt:
E-mail: barnea@me.com
WhatsApp: +49 – (0)152 – 2573 4677